literaturkritik.de
Leser’s Traum
Das literaturwissenschaftliche Kompendium »Arno-Schmidt-Handbuch« ist ein verlässlicher Kompagnon durch Leben und Werk des auratischen Schriftstellers
In der Satirezeitschrift »pardon« erschien im Oktober 1973 eine Glosse Peter Knorrs mit dem Titel: »Wer hat sich den bloß einfallen lassen?« Anlass ist der mit 50.000 D-Mark dotierte Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main gewesen, der im Vormonat dem legendenumrankten Schriftsteller Arno Schmidt (1914-1979) verliehen worden war. Knorr stellte zehn hochamüsante Thesen zur Existenz (oder genauer: Nicht-Existenz) »diese[r] seltsamste[n] Figur der deutschen Literaturszene« auf, über die es in der zweiten unmissverständlich heißt: »Es gibt ihn [Arno Schmidt] gar nicht. Und das Gegenteil soll er erst mal beweisen. Fest steht doch: er ist zur Entgegennahme des diesjährigen Goethe-Preises in Frankfurt nicht erschienen. Statt dessen hat eine (seine?) Frau Schmidt Geld und Ehren in Empfang genommen. Die kann ja wirklich so heißen; was sagt das?« [Weiterlesen auf literaturkritik.de]
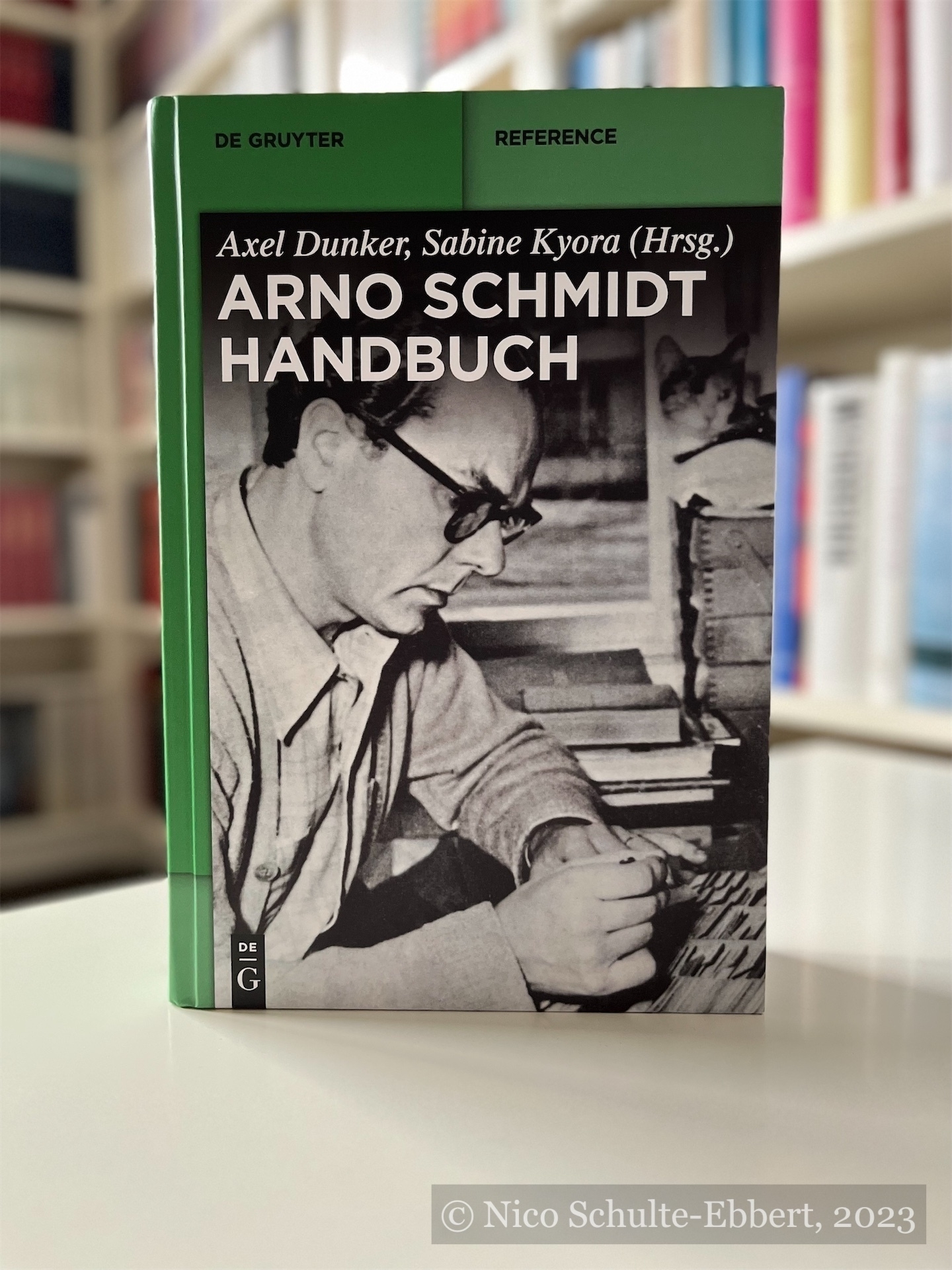 Rezensionsexemplar: Arno-Schmidt-Handbuch
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2023)
Rezensionsexemplar: Arno-Schmidt-Handbuch
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2023)
Transatlantischer Stromkreis
Der Briefwechsel zwischen Hans Blumenberg und Hans Jonas zeigt die Interferenzen zweier großer Gelehrter von 1954 bis 1978
Im Physik-Unterricht hat man gelernt, dass ein elektrischer Stromkreis, der aus Spannungsquelle und Leiter besteht, mit einem Flüssigkeitskreislauf vergleichbar ist, der sich aus einer Zirkulationspumpe und einem geschlossenen Leitungssystem zusammensetzt. Die Analogie erleichtert das Verständnis; sie macht das Unsichtbare sichtbar. Hans Blumenberg (1920–1996) bediente sich dieser Metapher in einem Brief vom 12. November 1955 an Hans Jonas (1903–1993), den von ihm bewunderten, siebzehn Jahre älteren Philosophen und Gnosis-Forscher, der seine deutsche Heimat 1933 kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen hatte: Blumenberg wünschte sich, Jonas nach über zwanzig Jahren im britischen, palästinensisch-israelischen und kanadischen, später dann im amerikanischen Exil »in den Stromkreis des deutschen Geisteslebens wieder eingeschaltet und in ihm wirksam zu sehen«. Weiterlesen auf literaturkritik.de
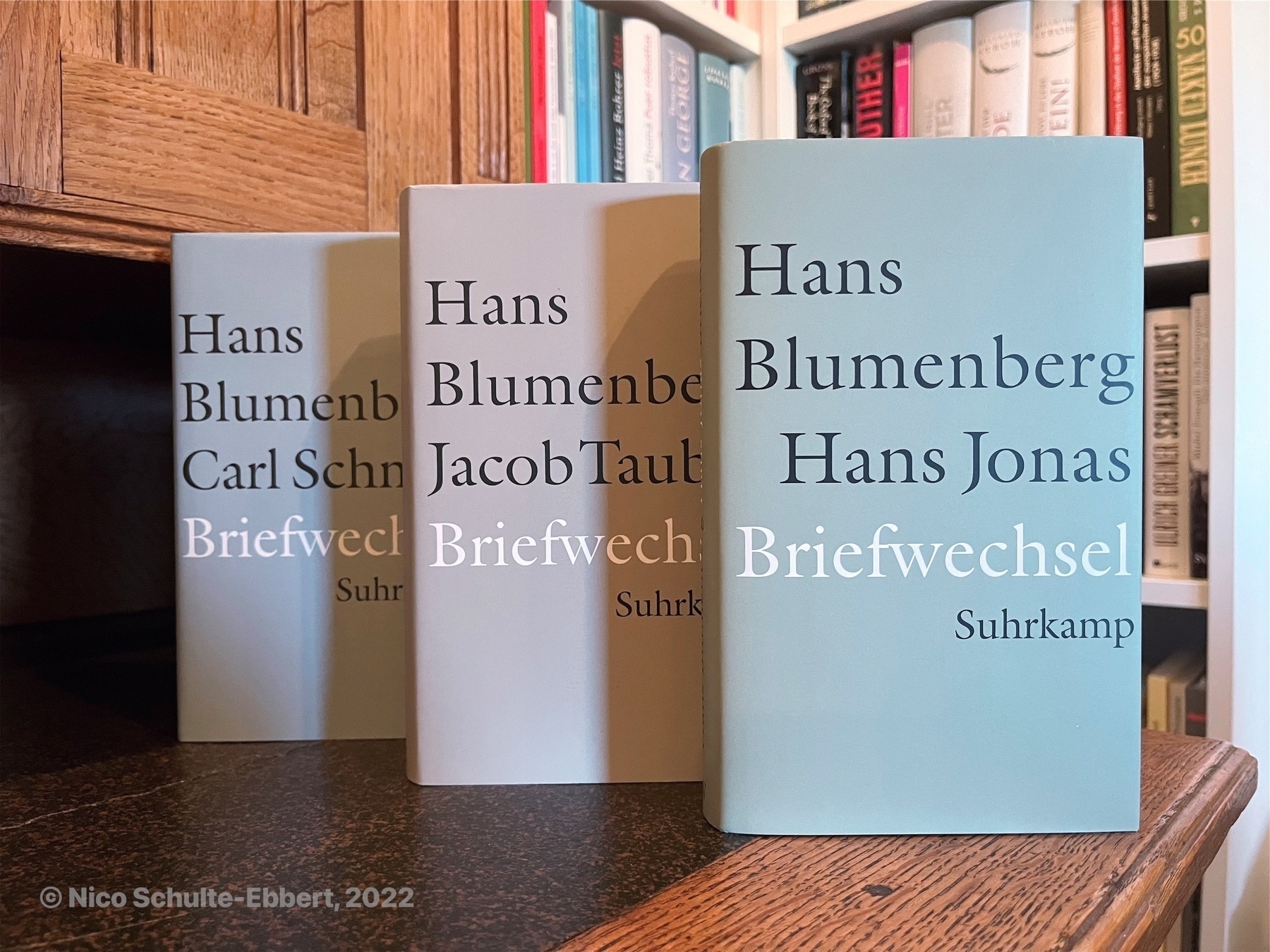 Rezensionsexemplar: Briefwechsel Hans Blumenberg/Hans Jonas
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)
Rezensionsexemplar: Briefwechsel Hans Blumenberg/Hans Jonas
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)
Der Grauseher
Peter Sloterdijk setzt in »Wer noch kein Grau gedacht hat« eine unscheinbare Unfarbe geistreich in Szene
In seiner Februar-Ausgabe des Jahres 1974 druckte das amerikanische Magazin High Fidelity einen Text ab, der den seltsam anmutenden Titel »Glenn Gould interviewt Glenn Gould über Glenn Gould« trug. In diesem höchst amüsanten Vexierspiel der Identitäten, für das der kanadische Ausnahmepianist Glenn Gould (1932–1982) eine lebenslange Leidenschaft empfand, findet sich die folgende Passage, in der es um Ästhetik und Moral geht: Weiterlesen auf literaturkritik.de
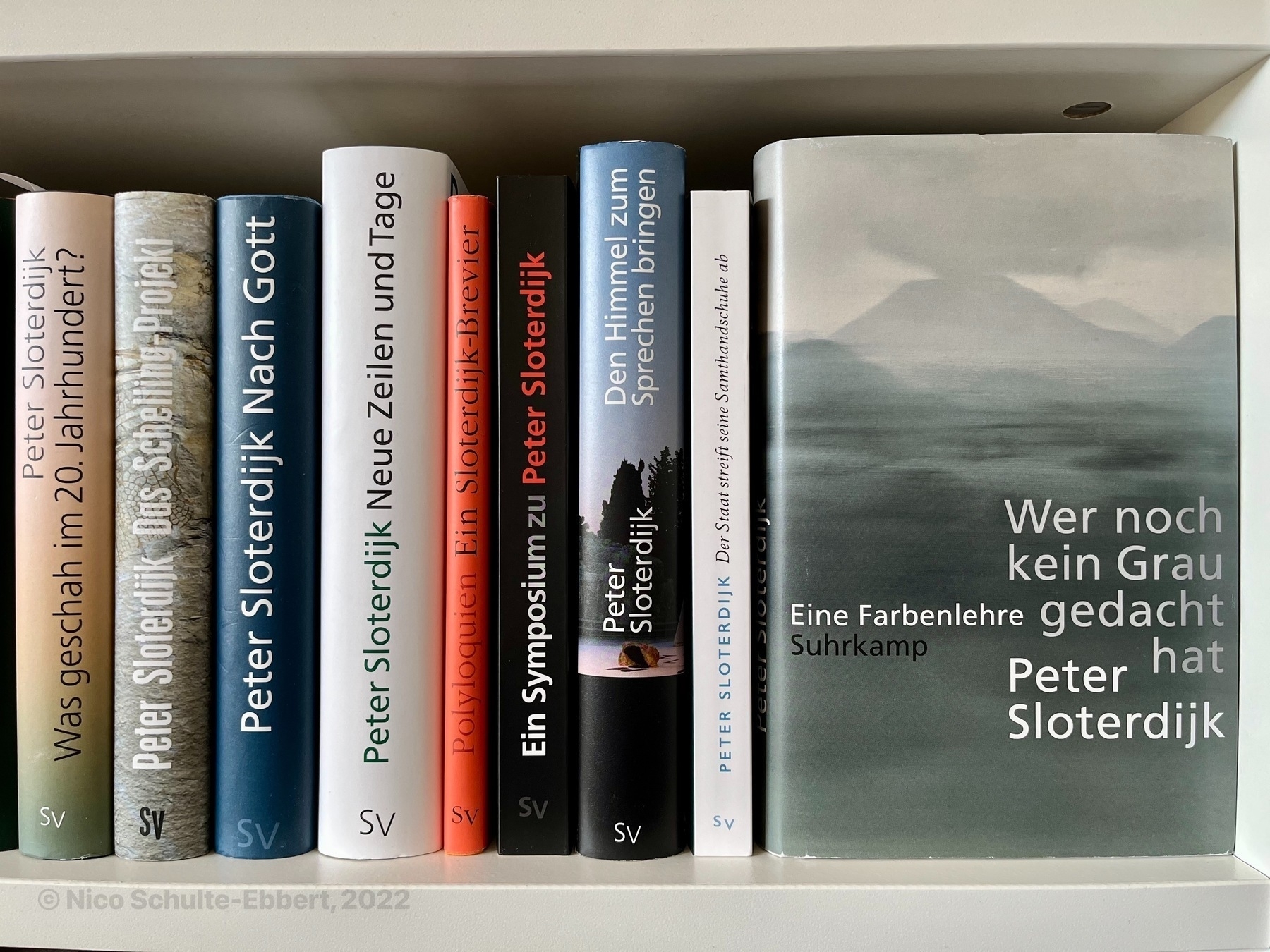 Rezensionsexemplar: Peter Sloterdijks »Wer noch kein Grau gedacht hat«
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2022)
Rezensionsexemplar: Peter Sloterdijks »Wer noch kein Grau gedacht hat«
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2022)
Dialoge der Aufklärung
In seiner Autobiographie »Ins Denken ziehen« ist der Philosoph Dieter Henrich ganz bei sich selbst
»Am Morgen des 26. April 1973«, heißt es in einem kürzlich erschienenen Beitrag von Jared Marcel Pollen in Tablet, einem Online-Magazin für jüdische Nachrichten, Ideen und Kultur, »verfolgten Agenten der tschechoslowakischen Geheimpolizei (StB) in Zivil ›einen unbekannten Mann, etwa 40 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, mit länglichem Gesicht, schwarzem, schütterem Haar, heller Brille …, der eine Papptafel mit einer Karte von Prag bei sich trug…‹.« Bei dem hier in einer KGB-Akte Beschriebenen handelt es sich um den amerikanischen Schriftsteller Philip Roth (1933-2018), der sich mit einem Besuchervisum in Prag aufhielt und dem die Staatssicherheit deshalb den Fallnamen ›Turista‹ – der Tourist – zuwies. Weiterlesen auf literaturkritik.de
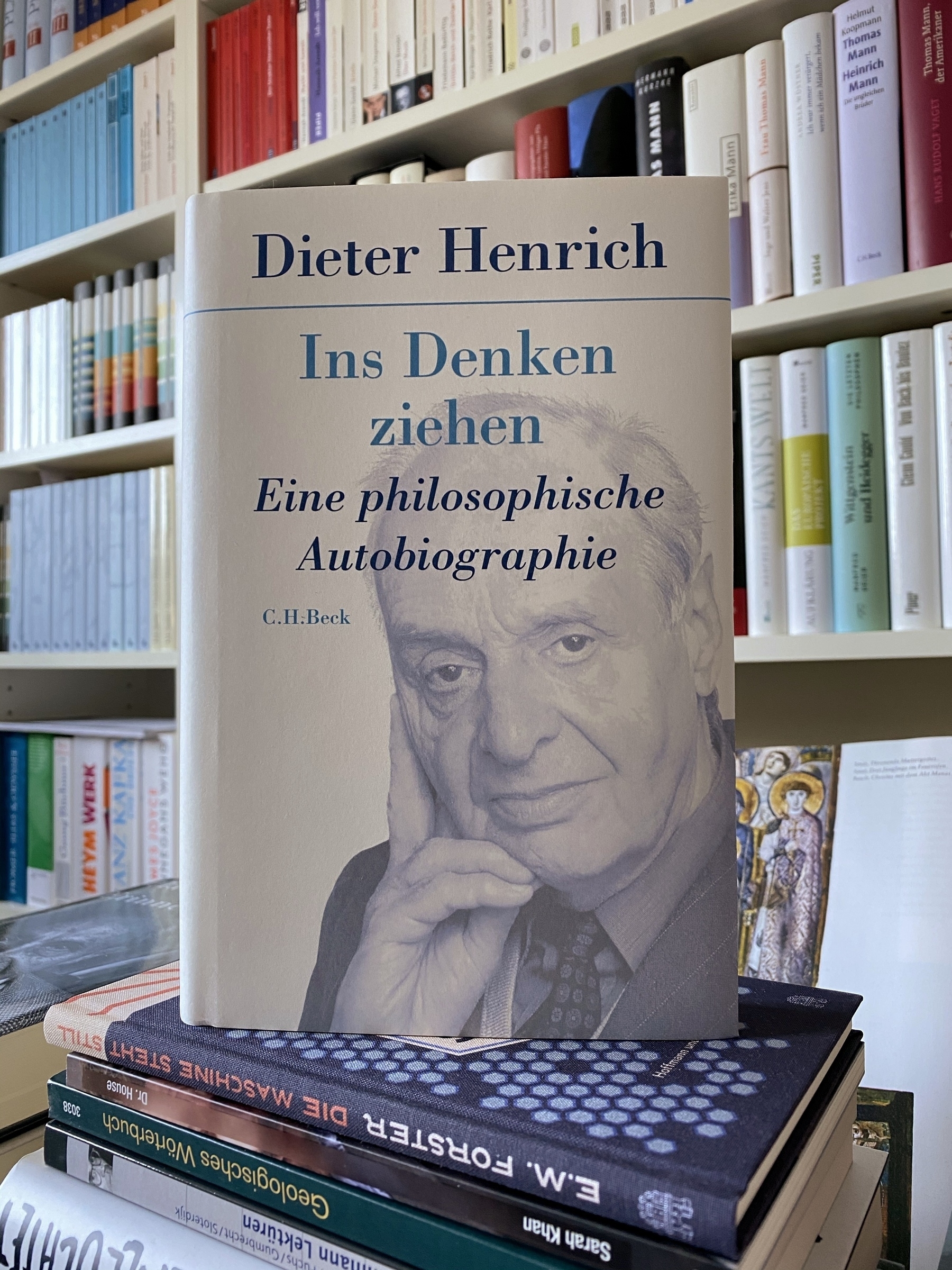 Rezensionsexemplar: Dieter Henrichs Autobiographie »Ins Denken ziehen«
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2021)
Rezensionsexemplar: Dieter Henrichs Autobiographie »Ins Denken ziehen«
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2021)
Die Beständige
Ingeborg Villinger beleuchtet erstmals das Leben von »Gretha Jünger«
Im 14. Kapitel seiner 1939 erschienenen Parabel Auf den Marmorklippen beschreibt Ernst Jünger (1895–1998): »Es hieß, daß Pater Lampros einem altburgundischen Geschlecht entstamme, doch sprach er niemals über die Vergangenheit. Aus seiner Weltzeit hatte er einen Siegelring zurückbehalten, in dessen roten Karneol ein Greifenflügel eingegraben war, darunter die Worte ›meyn geduld hat ursach‹ als Wappenspruch. Auch darin verrieten sich die beiden Pole seines Wesens – Bescheidenheit und Stolz.« [Weiterlesen auf literaturkritik.de]
 Rezensionsexemplar: Ingeborg Villingers Gretha-Jünger-Biographie
Rezensionsexemplar: Ingeborg Villingers Gretha-Jünger-Biographie
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2020)
Aktenzeichen FK (un-)gelöst. Benjamin Balints »Kafkas letzter Prozess« ist (leider) mehr als eine Gerichtsreportage
Etwas zu besitzen bedeutet, darüber verfügen zu können. Ein Besitz ist das Gut, das jemandem gehört. Doch das, was in Besitz genommen wurde, kann sich zur Besessenheit entwickeln, kann seinen Besitzer selbst besitzen, ihn in Anspruch nehmen, was einst dem Teufel vorbehalten war. Wer besitzt wen, wer hat die Kontrolle in diesem fanatischen Belagerungsspiel? [Weiterlesen auf literaturkritik.de]
Geschwisterähnlichkeiten
Das Lesen von Briefen, die nicht für einen selbst, geschweige denn für eine breite Öffentlichkeit bestimmt sind, umgibt eine Aura des Verbotenen; man bricht in die Privatsphäre, in Gedanken und Gefühle anderer Menschen ein wie in eine Bank oder ein Haus. Warum sollte man das tun? Warum sollte man das Briefgeheimnis verletzen? Aus purem Voyeurismus? Oder doch eher aus Forscherinteresse, das in den Briefen einen unmittelbaren biografischen Wert sieht? Antworten auf derartige Fragen liegen im Status der Briefeschreiber. So stellte Émile Zola in einem Aufsatz anlässlich des 1876 veröffentlichten Briefwechsels Honoré de Balzacs fest:
Gewöhnlich erweist man den berühmten Männern mit der Veröffentlichung ihres Briefwechsels einen sehr schlechten Dienst. Sie wirken darin fast immer egoistisch und kalt, berechnend und eitel. Man sieht darin den großen Mann im Schlafrock, ohne Lorbeerkranz, außerhalb der offiziellen Pose; und oft ist dieser Mann kleinlich, ja sogar schlecht. Nichts dergleichen bei Balzac. Im Gegenteil, sein Briefwechsel erhöht ihn. Man konnte in seinen Schubladen stöbern und alles veröffentlichen, ohne ihn auch nur um einen Zoll zu verkleinern. Er geht aus dieser schrecklichen Bewährungsprobe tatsächlich sympathischer und größer hervor.
Man kann sich also weiter fragen: Erhellt die Korrespondenz, diese »schreckliche Bewährungsprobe«, die musikalisch-künstlerischen, philosophisch-schriftstellerischen oder wissenschaftlichen Werke der Korrespondierenden, gibt sie also Zeugnis über Abläufe hinter den (persönlichen und soziokulturellen) Kulissen, oder findet sich in ihnen nur Belangloses, Intimes, Kompromittierendes? Im letzteren Falle müssten wir als unbekannte, unbeabsichtigte Adressaten ein neues Vertrauensverhältnis aufbauen und respektvoll mit diesen Informationen umgehen. [Mehr von meiner Rezension der Wittgensteinschen Familienbriefe auf literaturkritik.de.]
Rezensions-Apps-emplar
In den vergangenen Wochen habe ich mich eingehender mit der iOS-App Drafts beschäftigt, was mich mehr und mehr von deren Vielfältigkeit und produktiver Mächtigkeit überzeugt hat. Ich habe mich daher zu folgendem Experiment entschlossen: Ich werde versuchen, die Rezension des mir heute Mittag durch die Redaktion von literaturkritik.de zugestellten Buches Wittgenstein. Eine Familie in Briefen (Haymon, 2018) komplett in eben jener App und mit deren Hilfe zu verfassen. Über die Vorteile und/oder die etwaigen Probleme dieser neuartigen Arbeits- und Textproduktionsmethode werde ich an anderer Stelle berichten.
(Dieser Blogeintrag wurde bereits in Drafts erstellt.)