Sprache
PPA, Teil 2
In den Sieben-Uhr-Nachrichten des Rundfunksenders WDR 3 hörte ich an diesem sonnigen Sonntagmorgen Außergewöhnliches, oder besser gesagt: Außerordentliches:
In Köln beginnt um 11 Uhr die große Parade zum ›Christopher Street Day‹. Rund 60.000 Teilnehmende haben sich für den CSD angemeldet. Das sind ungefähr sechsmal mehr als beim Rosenmontagszug.
Ich fragte mich, wie das möglich sein kann: Wie kann es bereits 60.000 Teilnehmende geben, wenn die Veranstaltung noch gar nicht begonnen hat? Handelt es sich bei diesen Teilnehmenden nicht bis 11 Uhr vielmehr um 60.000 Angemeldete – oder mit zeitgeistig präziser Verrenkung: um ›Angemeldetseiende‹?
Natürlich eignen sich Partizipialsubstantive als Signal für ›Gendersensibilität‹ im medialen Soziolekt besonders gut vor dem Hintergrund einer solchen Großveranstaltung, denn: »Der diesjährige ›Cologne Pride‹«, so WDR aktuell weiter, »fordert uneingeschränkte gesellschaftliche Anerkennung für queere Menschen«.
Das ist löblich, begrüßenswert und wichtig. Anerkennung für grammatische und semantische Funktionen wird indes weniger prominent zelebriert: Es gibt keine Teilnehmenden einer noch nicht stattfindenden Veranstaltung, ganz gleich welche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität sie besitzen mögen. Die Teilnehmenden partizipieren nicht, und das klingt doch recht diskriminierend und ausgrenzend.
Angewandte Statistik
In der Financial Times schärft der 1967 geborene US-amerikanischer Science-Fiction-Autor Ted Chiang den Blick auf die Künstliche Intelligenz (KI), indem er sie anders und dadurch präziser bezeichnet:
Anthropomorphe Begriffe wie ›lernen‹, ›verstehen‹, ›wissen‹ und Personalpronomen wie ›ich‹, die KI-Ingenieure und Journalisten auf Chatbots wie ChatGPT projizieren, schaffen eine Illusion. Diese voreilige Kurzschrift
[_shorthand_]verleitet uns alle dazu, sagt er, selbst diejenigen, die mit der Funktionsweise dieser Systeme bestens vertraut sind, in KI-Tools einen Funken Gefühl zu sehen, wo es keines gibt. »Vor einiger Zeit gab es einen Austausch auf Twitter, bei dem jemand fragte: ›Was ist künstliche Intelligenz?‹ Und jemand anderes sagte: ›Eine schlechte Wortwahl im Jahr 1954‹«, berichtet Chiang. »Und, wissen Sie, sie haben Recht. Ich glaube, wenn wir in den 50er Jahren einen anderen Begriff dafür gewählt hätten, hätten wir vielleicht einen Großteil der Verwirrung vermieden, die wir jetzt haben.« Wenn er also einen Begriff erfinden müßte, wie würde er lauten? Seine Antwort ist schnell gegeben: angewandte Statistik.
So betrachtet, so bezeichnet, müßte die so bedrohlich wirkende KI heutiger Prägung unter dem Dach des Statistischen Bundesamtes (StBA) oder einer globalen Statistikbehörde à la Our World in Data untergebracht und benutzt werden.
Sich (auf) französisch empfehlen
Der Röhrich verrät, daß sich, wer ›sich auf französisch empfiehlt‹, sich heimlich davonmacht, ohne sich zu verabschieden. Wörter machen sich nur selten aus dem Staub derer, die selbst aus ihm erschaffen worden sind. Vielmehr verändert sich das Sprachmaterial im Laufe der Zeit, es paßt sich an und wandert häufig umher, grenzenlos und unbeirrbar.
Eine Überschrift im Figaro erregte vor einigen Tagen meine Aufmerksamkeit: Der Artikel versprach migrantische Wortgeschichte, französisch-deutsche Etymologie, termingerecht veröffentlicht zum sechzigsten Jahrestag des Élysée-Vertrages und versehen mit dem großtönenden Hinweis »auf fünf Wörter zurückzukommen, die Goethes Sprache dem Französischen verdankt«.
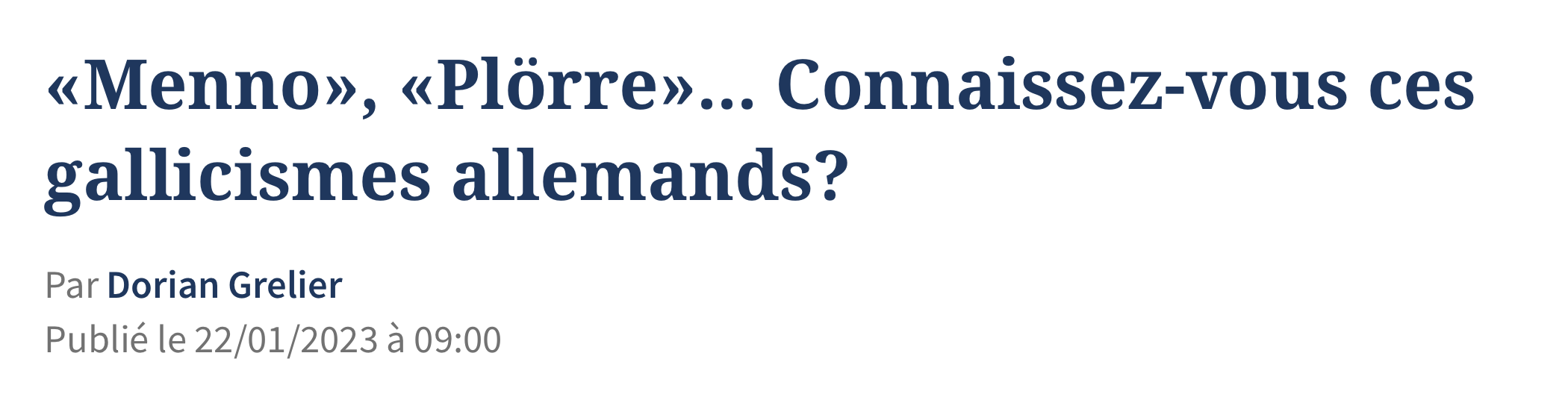 Überschrift im Figaro vom 22. Januar 2023
(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2023)
Überschrift im Figaro vom 22. Januar 2023
(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2023)
In der Tat sind die fünf Beispiele, die Dorian Grelier knapp und leserfreundlich vorstellt, wohlgewählt; bis auf das offensichtliche »Allure« für Allüren haben sich die vier anderen Wörter doch recht gut im deutschen Munde verstecken können. Daß sich hinter dem eingeschnappten »Menno!« das französische »Mais non!« verbirgt, daß sich das pingelig-feine »Etepetete« aus »être, peut-être« entwickelt haben soll, daß die ungenießbare »Plörre« tränenreich im französischen »pleurer« aufgeht, wohingegen der hochwertige »Moka«-Kaffee über den falschen, also schlechten, Moka zu »Muckefuck« degradiert wurde (was die Frage aufkommen läßt, ob man diesen nicht auch als »Plörre« hätte bezeichnen können), ist Völkerverständigung par excellence.
Wer nur geringe französische Sprachkenntnisse habe, so weiß der Röhrich zu berichten, ›spricht französisch wie die Kuh spanisch‹. Weder in der Politik noch in der Sprache sollte man sich auf einen Kuhhandel einlassen.
Lutz Röhrich. »französisch.« Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 2: Easy-Holzweg. 3. Aufl., Herder, 1994, pp. 470-1.
Dorian Grelier. »›Menno‹, ›Plörre‹… Connaissez-vous ces gallicismes allemands?« Le Figaro, 22/01/2023, https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/menno-plorre-connaissez-vous-ces-gallicismes-allemands-20230122.
Zivilisationsliterat
Die New York Review of Books druckt einen Essay des 1956 geborenen Politikwissenschaftlers Mark Lilla ab, der in etwas veränderter Form als Einleitung zu der am 18. Mai erschienenen Neuausgabe von Thomas Manns Reflections of a Non-political Man fungiert. Darin heißt es unter anderem:
Who, then, is the intellectual proponent of »politics«? Mann calls him the Zivilizationsliterat
[sic!], an unlovely term even in German, which the English translator, Walter D. Morris, renders as »civilization’s literary man.« (A better translation might simply have been »Heinrich.«)
Der Literat als Gegensatz, als Feind des Ästheten, des wahren Künstlers, ist in Thomas Manns Augen sein älterer Bruder Heinrich, und genau auf diese Geschwisterungleichheit, ja diesen Brüderzwist spielt Lilla mit seinem Übersetzungsvorschlag augenzwinkernd an.
Mark Lilla. »The Writer Apart.« The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 8, May 13, 2021, pp. 18-21, hier p. 20.
Die Welt als Tweet und Vorstellung. Stephan Porombkas E-Book »Über 140 Zeichen« versammelt sechzehn Twitter-Poetologien
Ob Jack Dorsey voraussehen konnte, wie sich sein Kurznachrichtendienst Twitter entwickeln würde, als er am 21. März 2006 die simple Nachricht »just setting up my twttr« als allerersten Tweet absetzte? Daß Twitter inzwischen viel mehr als nur eine andere, eine digitale Live-Ticker-Plattform für jedermann ist, zeigen unzählige Kreative, die ›an den Grenzen der Timeline‹ twittern und so eine neue Art von Kommunikation, Kunst, Literatur erschaffen.
Sechzehn dieser kreativen Twitterer hat der Berliner Literatur- und Kulturwissenschaftler Stephan Porombka (sich selbst eingeschlossen) in einem im März 2014 beim Frohmann-Verlag erschienenen E-Book versammelt, um einen »Einblick in ihre Twitterwerkstatt« (so der Untertitel) zu bekommen, ihnen also quasi eine Selbstreflexion ihrer Twitter-Strategie, ihres Schreibens, Lesens und Kommunizierens abzuverlangen. Dabei kommt der Präposition über, die sich im Titel findet, besonderes Gewicht zu.
»Über 140 Zeichen« bezieht sich einerseits auf die simple Feststellung, daß die im vorliegenden E-Book versammelten Essays über die von Twitter vorgegebene 140-Zeichen-Begrenzung hinausgehen, also mehr oder länger als ein Tweet sind. Andererseits signalisiert das Über die Behandlung eines bestimmten Themas, wie man es von Titeln antiquiert klingender Studien kennt, von Ciceros De oratore etwa, von Nietzsches »Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne«, ja auch von Sloterdijks Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik – in diesem Falle also: Über Twitteroder: Über Tweets oder: Über das Twittern.
Bereits mit der Ambivalenz des Titels wird ein maßgeblicher Wesenszug Twitters deutlich: Der enge Raum, der zur Verfügung steht, wird durch Doppeldeutigkeiten, durch Wortspiele, ja sogar durch Verkürzungen aufgesprengt und erweitert: »Die Kunst: Komplexes andeuten und mit einer epischen Geschichte in wenige Zeichen eindampfen. Gähnend uninteressante Abläufe in dekorativer Sprache komplex aufblasen oder faszinierende Vorkommnisse mit derber Sprache minimalisieren.« (@Chouxsie) Autor und Leser, Twitterer und Follower finden hier, so könnte man sagen, eine Idylle vor, die Jean Paul in seiner Vorschule der Ästhetik als »Vollglück[] in der Beschränkung« definiert.
In dieser Idylle als »Twitterwerkstatt« blühen Gedanken, Welten, Sprache(n); der Mikrobloggingdienst wird zum »Mikromagazinleben« (@sinnundverstand), zum »Sprachkunstdienst« (@Chouxsie), zum »Jump-’n’-Run-Spiel« (@FrohmannVerlag). Und es ist gerade der Spielcharakter des Twitterns, das Twittern als (durchaus auch im Wittgensteinschen Sinne zu verstehendes) Sprachspiel, eine Praxis, in der mit und durch Sprache gespielt wird, was in allen hier versammelten Beiträgen als verbindendes und äußerst positives Hauptmerkmal durchscheint: Twitter als »Wir-Spielautomat«, als »Lernspiel«, als »Strategiespiel«, als »Open-World-Spiel«, als »Wir-Ego-Shooter-Spiel« (@FrohmannVerlag). Die sechzehn Autoren, von denen einige ihre Twitter-Maske auch in ihren Essays nicht absetzen und mit ihrer Kunstfigur in Dialog treten, mit einem anderen Ich spielen, es sprechen lassen (@NeinQuarterly hält sich in seinem Beitrag konsequent an die Raumbeschränkung und geht nicht ›über 140 Zeichen‹ hinaus), nennen Spiel, Zufall, Narzißmus als Tweet-Impetus: »Auf Twitter geht es für mich nur um eine Sache: mich selbst. Es ist das perfekte Medium für Menschen, die gleichermaßen narzisstisch und nur bedingt gesellig sind.« (@Wondergirl)
Zugleich geht es in den Mikro-Poetologien auch immer wieder um die Frage nach der Literarizität Twitters: »Dem Wesen nach aber sind Tweets eine Textform, die auf die nächste (oder fernste) Zukunft abonniert ist.« (@HansHuett) Nach dem Tod des Autors zeigt uns Twitter dessen Auferstehung in 140 Zeichen. @HansHuett sieht in Tweets die »nächste Literatur« emporsteigen: »Zusammenfügen, Kuratieren und Dichten«. Und auch @MannvomBalkon, dessen Twitter-Überlegungen äußerst gewinnbringend sind, erkennt in Tweets literarische Qualitäten: »Denn Twitter, diese ›nächste Literatur‹, ist ihrer Natur nach eine Literatur der Unruhe. Sie entsteht aus der Unruhe, sie beschreibt diese Unruhe und sie wird in der Unruhe rezipiert und kommentiert.« (@MannvomBalkon)
Neben der Frage nach Relevanz, der Suche nach Pointen, dem Umgang mit Sucht ist es eben die Flüchtigkeit, die das Twittern als neue Literaturform ausmacht: »Nebenbei ist Twittern nichts anderes als Kritzeln. Kritzeln mit Buchstaben. Das rasch Hingeworfene, nur mit wenigen Strichen Umrissene macht den Reiz aus. Für genaue Beschreibungen ist kein Platz. Hier ein Strich, dort ein Kritzel-Kratzel, zack – raus!« (@sinnundverstand) Dieses »Schreiben in nervösen Zeiten in einem nervösen Medium« (@Anousch) ist zudem oftmals maßgeblich vom Zufall geprägt. Im 36. Paragraphen seiner Morgenröthe schreibt Friedrich Nietzsche: »Und doch liegt auf der Hand, dass der Zufall ehemals der grösste aller Entdecker und Beobachter und der wohlwollende Einbläser jener erfinderischen Alten war, und dass bei der unbedeutendsten Erfindung, die jetzt gemacht wird, mehr Geist, Zucht und wissenschaftliche Phantasie verbraucht wird, als früher in ganzen Zeitläuften überhaupt vorhanden war.«
Eben den Zufall beschreibt @stporombka in seinem lesenswerten Werkstattbericht: »Es beginnt mit dem Zufall, der die Idee des Schicksals ablöst und lieber mit Wahrscheinlichkeiten, Risiken und den Fragen einer auf die Zukunft hin offenen Gegenwart umgeht.« (@stporombka) In einer Alltagsbeobachtung werden Licht und Schatten, Text und Bild miteinander verquickt, photographiert, getwittert; das Verbinden des Unverbundenen, das Zusammenbringen des Auseinanderliegenden, die Sichtbarmachung des Unsichtbaren – all dies ist Signum einer neuen Kunst, einer nächsten Literatur, einer morgigen Art des Präsentierens, Teilens, Kommentierens, die heute schon Alltag ist: »Die Kunst ist fasziniert davon, dass diese Bewegung auf spielerische Weise neuen Sinn erzeugt.« (@stporombka)
Und da ist es wieder: das Spiel, das Twitter ist, Twitter, das ein Spiel ist, »ein Spiel frei schwebender Aufmerksamkeit« (@HansHuett), was der Literaturwissenschaftler Roland Reuß in seiner 2012 erschienenen Meditation Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch kritisiert: »›Online‹-Sein«, so Reuß, »bedeutet perforierte Aufmerksamkeit.« Man möchte diese negative Einschätzung der digitalen Welt im allgemeinen positiv auf Twitter im besonderen ummünzen: »Die Epen verpuffen, aber einen Gedanken, der das Beobachtete kondensiert, den kann ich behalten, umformen, immer weiter komprimieren, bis er in 140 Zeichen passt.« (@UteWeber) Hier und in anderen Beiträgen aus der »Twitterwerkstatt« kommt Konzentration zum Vorschein, Konzentration auf das Flüchtige, das einerseits schnell und ›im Flow‹, andererseits korrigiert, umgeschrieben, nachbearbeitet und erst über den Umweg des Entwürfe-Ordners getwittert wird, um ein möglichst perfektes Kunstwerk als ›Kunstzwerg‹ zu erschaffen: »Was ich gern möchte, ist ein gewisser eigener ›Twist‹ in den Tweets. Ein besonderer Reiz in der Formulierung, etwas Angeschärftes, etwas, das verdutzen lässt. Ein Bruch, ein Riss, eine Perspektivumkehr, ein Ebenenwechsel.« (@MannvomBalkon)
Interessant erweist sich die teils jahrelange Genese der Twitter-Autoren von einfachen Followern einfacher News- oder Promi-Accounts zu kreativen Wortführern mit eigenen Themen, eigener Sprache, eigenem Stil. So zeigen die Beiträge eindringlich, spielerisch, ja auch verrückt das Finden einer zunächst fremden Stimme auf, die im Twitter-Universum als die eigene adaptiert, gepflegt sowie stets ein-, um- und neugestimmt wird: »Die Kunst des Twitterns ist vielleicht, diesen Anfang zu überwinden, seine Stimme zu finden und seine Inhalte, dabei seiner Blase zu entkommen, neue Blasen zu finden und auch bei Zeiten bereit sein, sie wieder platzen zu lassen.« (@Milenskaya)
Der Leser erfährt in Über 140 Zeichen viel über unterschiedliche poetologische Konzepte, über Inspirationsquellen, Intentionen, Inhalte, Impulse und Interaktionen mit anderen Twitterern. Teilweise sind die Essays mit Tweets der jeweiligen Autoren durchsetzt, als anschauliche Beispiele einerseits, als Auflockerungen des Meta-Textes andererseits, was Lust am Text bedeutet und Lust auf Text oder präziser: Lust auf Tweets und das Twittern macht. Das Nachwort @stporombka’s, das ich mir als Vorwort gewünscht hätte, überzeugt als Skizze poetologischer Reflexionen, als historischer Blick auf den Umgang mit und den Einblick in die Werkstatt des Autors vom 18. Jahrhundert bis in die digitale Gegenwart, in der der Literatur- und Textbegriff erweitert wird und sich harscher Kritik, ja geradezu »Bremsversuchen« ausgesetzt sieht: »Statt mit den neuen Formen zu experimentieren und auch ihre kritischen, widerständigen Möglichkeiten zu testen, wird jeder, der online ist und postet, twittert, faved oder liked, erstmal darauf verpflichtet, das schlechte Gewissen zu haben, nichts Sinnvolles zu tun und mehr noch: an der kulturellen Sinnentleerung teilzuhaben.« (@stporombka)
Als Abschluß des E-Books finden sich »Twitterbiografien«, die genauer als »Twittererbiographien« bezeichnet werden müßten, aus denen hervorgeht, daß sich einige der hier vorgestellten Autoren bereits mit eigenen Veröffentlichungen ›über 140 Zeichen‹ hervorgetan haben oder noch hervortun werden. Dies verspricht nicht weniger spannend zu sein als die hier vorgestellten Mikro-Poetologien des Twitterns: »Wie ich Tweets verfasse, kann ich kaum beschreiben. Sie kommen oder sind schon da. Wie soll ich den Geburtsort wüster Gedankenblitze beschreiben?« (@Chouxsie)

Über 140 Zeichen. Autoren geben Einblick in ihre Twitterwerkstatt
Hg. Stephan Porombka
Berlin: Frohmann, 2014
E-Book (ePub, mobi, pdf)
Preis: EUR 2,99
ISBN: 978-3-944195-24-7
Diet of Worms
Ich habe gerade zufällig herausgefunden, daß der Wormser Reichstag im Englischen mit »Diet of Worms« zu übersetzen ist, was natürlich zu einer ungemein komischen Doppeldeutigkeit hinsichtlich der Ernährungsweise wirbelloser Tiere führt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Diet_of_Worms
[Ursprünglich gepostet auf Google+]
Searle in Münster
Nun, da ich mit meinem Projekt Proust 2013 begonnen habe, entdeckte ich zufällig auf Seite 178 des ersten Bandes einen Notizzettel, den ich am 8. Dezember 2009 angefertigt hatte. An diesem Tag, an dem ich in einem Antiquariat die zehnbändige Recherche in der Übersetzung Eva Rechel-Mertens gekauft hatte (Suhrkamp, 1979), hielt John R. Searle im Rahmen der 13. Münsterschen Vorlesungen zur Philosophie einen öffentlichen Vortrag mit dem Titel »Language and Social Ontology«. Ich erinnere ihn als einen kleinen, ruhigen, bestimmt und klar sprechenden Mann, der vor der Tafel im Audi Max auf und ab ging, und der im Anschluß auf jede Frage aus dem Plenum offen und geduldig einging. Auf meinem Zettel steht folgendes:
»status function (declaration); status functions (institutional facts); deontic powers (language as the home of d. p.); desired independent reasons for actions.
1.) Collective Intentionality
2.) Status Function
3.) X counts as Y in C (context)«
Natürlich versäumte ich es, mir nach den Fragen eine Unterschrift Searles zu ergattern. Ein »Have a nice night« bekam ich allerdings als Entschädigung von ihm zu hören.
https://www.uni-muenster.de/PhilSem/veranstaltungen/mvph/searle/searle.html
[Ursprünglich gepostet auf Google+]
Übersetzung
»Damn it – don’t translate what I wrote, translate what I meant to write.« Ein lesenswertes Interview mit der Übersetzerin Eva Hesse über Sprache, Begegnungen mit Ezra Pound und Katzen als Lehrer: »Schließlich gab es auch noch meinen Kater Pussy, der ist auf vielen berühmten Leuten gesessen. Er hat sich breitgemacht wie ein Fladen, von ihm habe ich gelernt, was ›besitzergreifend‹ heißt.«
»Warum kommen Sie nicht von Pound los? Im Gespräch mit Eva Hesse.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Aug. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/im-gespraech-mit-eva-hesse-warum-kommen-sie-nicht-von-pound-los-11842691.html.
[Ursprünglich gepostet auf Google+]
›E‹piphanien oder: Der große Meaulneskin›e‹
Menschen sind wie Buchstaben: sie erscheinen, nehmen Gestalt an, verkümmern, werden mißachtet und verschwinden schließlich in den Annalen des Kollektivgedächtnisses. Manche sind unaussprechlich; man weiß nicht, wie man ihnen gerecht wird. Sie sind Symbole: sie fallen zusammen, fallen mit anderen, mit ihren Gegenstücken zusammen und trennen sich wieder. Bei manchen ist man sich unsicher, woher sie überhaupt kommen …
Der Begriff ›Moleskin‹ bezeichnet ein robustes Textil, in dem der englische Arbeiter häufig erschien. Vielleicht war auch der Bauernfilzhut, den Augustin Meaulnes bei seiner ersten Erscheinung trug, mit eben jenem magischen Stoffe überzogen. Diese frühe Verbindung, die dem aufmerksamen Denkenden in sein ungetrübtes Auge fällt, ereignet sich am Ausklang des 19. Jahrhunderts: »An einem Novembertag des Jahres 189… kam er zu uns.« (Henri Alain-Fournier, Der große Meaulnes)
Ähnlich der imposanten und mit dem Zauber des Mysteriums umgebenen Gestalt des 17jährigen Schülers erscheint ein Vokal aus den Tiefen der linguistischen Kreativität: ›Moleskine‹, ein Begriff, dessen Herkunft und Aussprache nicht weniger Kopfzerbrechen verursacht als das seltsam-romantische Herumirren des großen ›Fährtensuchers‹.
Ein französischer Buchbinder aus Tours wagt es, in dreister Impertinenz, nicht nur die englische ›Maulwurfshaut‹ mitsamt ihrer Bezeichnung zu importieren, sondern auch, ihr ein ›e‹ anzufügen, um die nasale Endung zu umgehen und annäherungsweise der französischen Zunge einen britischen Schlag beizubringen. Dieser phonologische Kniff stellt jedoch keineswegs einen Angriff auf beziehungsweise eine Abschottung von der Metaphysik dar, wie sie im ›a‹ der ›différance‹ zum Ausdruck kommt; er führt zwei Liebende zusammen. Wie Augustin Meaulnes Yvonne de Galais verzweifelt zu finden versucht, sie schließlich findet und sie ihm schicksalhaft entrissen wird, so fügt sich auch das ›e‹ an ›Moleskin‹ an, eine Verbindung, über die man in Platons Symposion liest: »Jeder von uns ist demnach nur eine Halbmarke von einem Menschen, weil wir zerschnitten, wie die Schollen, zwei aus einem geworden sind. Daher sucht denn beständig jeder seine andere Hälfte.«
Epiphanien der Hälften – das plötzliche Erscheinen von Symbolen, die etwas Bleibendes schaffen: flüchtige Notizen auf Papier und ein Kind, das ohne leibliche Eltern aufwächst. Man stellt sich Chatwin vor, der mit einem Koffer voller Moleskines beladen die Welt bereist, und gleichzeitig sieht man den großen Meaulnes, »wie er nachts seine Tochter in seinen Mantel hüllt[e], um mit ihr zu neuen Abenteuern aufzubrechen.«
