Die Tricks der Demagogen
Zufällig stoße ich bei YouTube auf den Teil eines Interviews mit dem Sozialphilosophen Max Horkheimer (1895-1973), in welchem dieser die folgenden demagogischen Charakteristika aufzählt:
- erheblicher Superlativ-Gebrauch;
- Einteilung in »die Guten« (das Wir) und »die Schlechten« (die Anderen);
- Fokussierung auf ein absolutes Ziel, das absolut gut ist;
- völliger Ausschluß des Zweifels;
- Verbrüderung mit Zuhörern (»Ich bin einer von Euch«);
- Überzeugung, daß gegen »uns« eine Verschwörung im Gange sei;
- Wiederholung dieser ›Tricks‹.
Es fällt nicht sonderlich schwer, hinter jeden dieser Kunstgriffe einen Haken zu setzen, wenn man etwa an die großen zeitgenössischen Volksverführer Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán oder Recep Tayyip Erdoğan denkt. Horkheimer betont, daß es eine »unendlich wichtige Sache« sei, die Tricks der Demagogen in Schule und Universität zu lehren und somit sichtbar zu machen, »damit die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig werden.«
Philosophy Overdose. »Adorno & Horkheimer Clips.« YouTube, 29.08.2019, [www.youtube.com/watch, 6:00-8:01.
Wovon träumen Schützen?
Vom Frieden, vom Ende des Krieges – davon träumen Schützen, zumindest erträumt sich dies der namenlose Fallschirmspringer in Pink Floyds 1983 veröffentlichtem Song »The Gunner’s Dream«, den Roger Waters nun als vierte »Quarantäne-Version« eines Pink-Floyd-Songs vorlegt. Die lose, noch überschaubare Serie der Lockdown Sessions begann am 17. Mai 2020 mit dem Song »Mother«, der 1979 auf The Wall erschienen ist. Waters’ kommentierte diese Version mit den Worten: »Soziale Distanzierung ist ein notwendiges Übel in der Covid-Welt. ›Mother‹ zu sehen, erinnert mich daran, wie unersetzlich die Freude ist, in einer Band zu sein.« Darauf folgte am 23. Juni 2020 »Two Suns in the Sunset« und schließlich am 6. August »Vera / Bring the Boys Back Home«. Und nun, nach einer Pause von fünf Monaten, »The Gunner’s Dream«:
In meiner Besprechung des Albums The Final Cut zu dessen 30. Jubiläum am 21. März 2013 hatte ich Roger Waters’ Stimme als »sanfte, ja rücksichtsvoll-einfühlsame« charakterisiert. Jetzt, im Alter von fast 78 Jahren, zeichnet sie zusätzlich etwas Leonard-Cohen-haftes aus, was hervorragend mit der stillen, minimalistischen Schwarz-Weiß-Atmosphäre des Videos harmoniert. Diese strahlt etwas Bedrückendes, etwas In-diese-Zeit-Passendes aus; die Band getrennt, die Menschen distanziert, das Leben eingefroren im Kampf gegen ein Virus.
Der Traum des Schützen ist und bleibt ein Traum.
Europatour [Extended Version]
Wie schon in der vergangenen Silvesternacht blickte ich auch in dieser auf die Zahlen der Zones-App, die im Vergleich zu denen des Vorjahres erneut gestiegen waren.
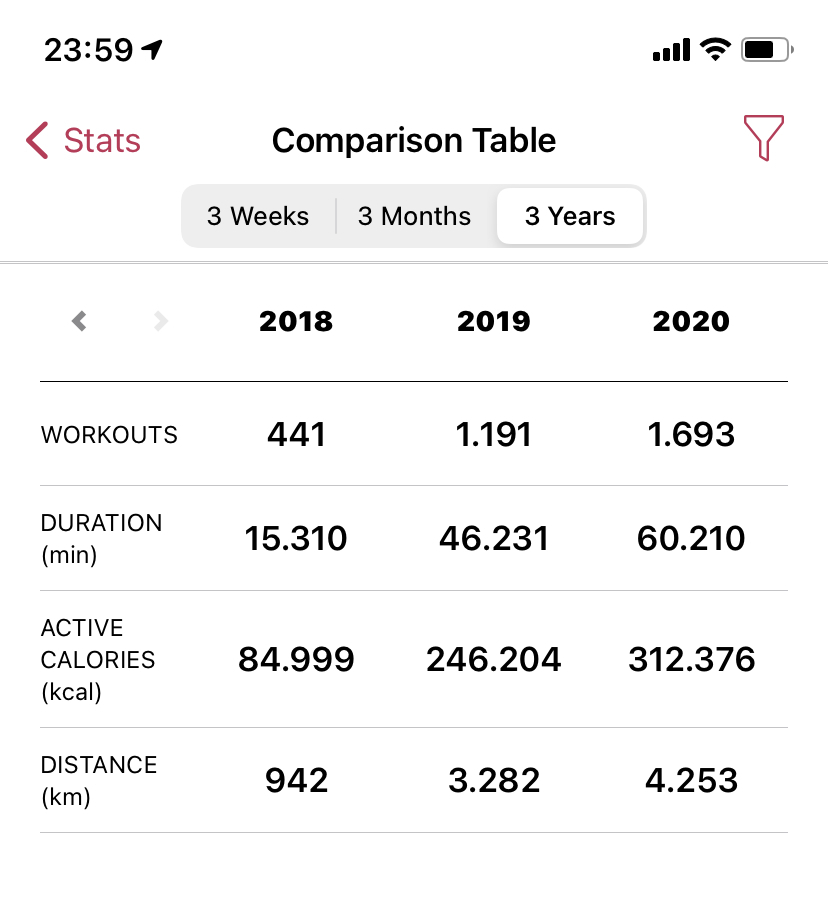
4.253 Kilometer habe ich per pedes im (ersten) Corona-Jahr zurückgelegt (das sind gut 11,6 Kilometer pro Tag), und damit 971 Kilometer mehr als noch 2019! Wieder öffnete ich die Karten-App, um diese abstrakte Zahl anhand einer konkreten Route zu veranschaulichen. Erneut wählte ich die Hauptstadt Portugals als Startpunkt meiner fiktiven Europatour aus. Das Ziel lag jedoch diesmal nicht in Polen.
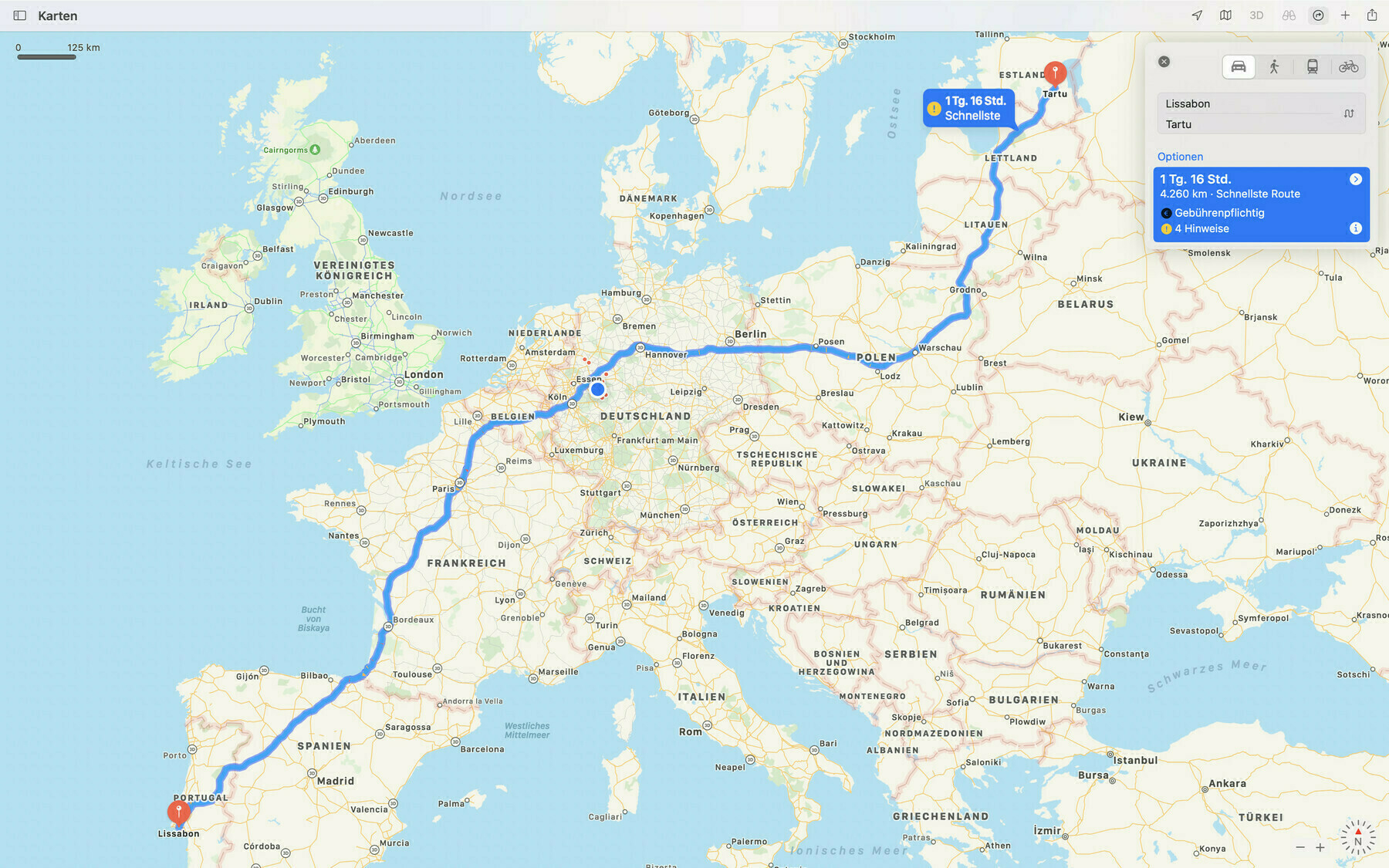
Führe man mit dem Auto von Lissabon durch Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, Litauen und Lettland bis nach Tartu, Estlands zweitgrößter Stadt, legte man mit etwa 4.260 Kilometern eine ähnliche Entfernung in einem Tag und sechzehn Stunden zurück, wie ich es zu Fuß innerhalb eines Jahres getan habe. Verrückt, welche Strecken man im Denkkerker durchmißt!
2020 – Mein Bücherjahr [Extended Version]
Am letzten Tag des Jahres werfe ich – wie schon 2012, 2017, 2018 und 2019 – einen chronologisch ausgerichteten Blick zurück auf die abwechslungs- und lehrreichen Bücher, die ich in den vergangenen zwölf Monaten lesen konnte. In diesem Jahr jedoch soll meine Leseliste eine extended version darstellen, sprich: nicht nur sind Monographien aufgeführt (die zur leichteren Orientierung im bibliographischen Dschungel fett markiert worden sind), sondern auch (Zeitungs-)Artikel, Aufsätze, Essays und Rezensionen. Wenn auch nicht alle Texte verzeichnet sind, so geben die folgenden 329 Titel doch einen recht guten Überblick über mein Lektürejahr 2020 im besonderen und das Corona-Jahr im allgemeinen. (Von der Aufzählung anderer in diesem Jahr von mir konsumierter Medien – etwa den 83 Titeln bei Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime, oder den über 1500 Podcast-Episoden von Deutschlandfunk über The Economist hin zu Mac Power Users – habe ich aufgrund des Umfangs Abstand genommen.)
[1]
Heinrich Niehues-Pröbsting. Von der Theologie zur Philosophie. Der Philosoph Hans Blumenberg. Ein Forum der Josef Pieper Stiftung. Herausgegeben von W. Hoye, H. Fechtrup und Th. Sternberg. Verlag der Akademie Franz Hitze Haus, 2016. Schriften der Akademie Franz Hitze Haus, Bd. XXI.
[2]
Hans Blumenberg. »Notizen zum Atheismus.« Aus dem Nachlaß. Neue Rundschau, 118. Jahrgang, Heft 2, 2007, pp. 154-60.
[3]
Ursula Reitemeyer. »Hans Blumenberg (1920-1996) – ein Grußwort.« Hans Blumenberg: Pädagogische Lektüren. Herausgegeben von Frank Ragutt und Tim Zumhof. Springer, 2016, pp. 17-20.
[4]
Uwe Wolff. Als ich ein Junge war. Liebeserklärung an Kindheit und Jugend in den Sechzigerjahren. Kösel, 2017.
[5]
Barbara Stollberg-Rilinger. »Aufrichtigkeit, Lüge und Verstellung.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/1, Frühjahr 2020, pp. 65-76.
[6]
Martin Mulsow. »Als Adam Weishaupt einmal fast einen Musikabend verdorben hätte. Fragment einer ungeschriebenen Biographie.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/1, Frühjahr 2020, pp. 93-104.
[7]
Christian Meier, Eva Geulen, Christoph Möllers, Petra Gehring, Patrick Bahners, Helmut Lethen und Danilo Scholz. »Über Minen laufen. Sieben Schneisen durch den Briefwechsel von Reinhart Koselleck mit Carl Schmitt.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/1, Frühjahr 2020, pp. 105-22.
[8]
Odo Marquard. »Entlastung vom Absoluten. In memoriam.« Die Kunst des Überlebens. Nachdenken über Hans Blumenberg. Herausgegeben von Franz Josef Wetz und Hermann Timm. 3. Aufl., Suhrkamp, 2016, pp. 17-27.
[9]
Hans Blumenberg und Uwe Wolff. »›Und das ist mir von der Liebe zur Kirche geblieben.‹ Hans Blumenbergs letzter Brief. Mit einem Nachwort von Uwe Wolf.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 173-81.
[10]
Uwe Wolff. »›Den Mann, den alle schlagen, diesen schlägst du nicht.‹ Hans Blumenbergs katholische Wurzeln.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 182-98.
[11]
Uwe Wolff. Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg. Claudius, 2020.
[12]
Benjamin Dahlke und Matthias Laarmann. »Hans Blumenbergs Studienjahre. Schlaglichter auf Orte, Institutionen und Personen.« Theologie und Glaube, 107. Jahrgang, 1/2017, pp. 338-353.
[13]
Birgit Recki. »Arbeit am Menschen. Hans Blumenberg in Münster.« Pietät und Weltbezug. Universitätsphilosophie in Münster. Herausgegeben von Reinold Schmücker und Johannes Müller-Salo. Paderborn, 2020, Sonderdruck.
[14]
Hans Blumenberg. »Das Fernrohr und die Ohnmacht der Wahrheit.« Sidereus Nuncius. Nachricht von neuen Sternen. Dialog über die Weltsysteme (Auswahl). Vermessung der Hölle Dantes. Marginalien zu Tasso, von Galileo Galilei. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Blumenberg. Insel, 1965, pp. 5-73.
[15]
Dorit Krusche. »›Marcellus non papa ex cathedra.‹ Zwei Begegnungen zwischen Hans Blumenberg und Marcel Reich-Ranicki.« Germanica, vol. 65, no. 2, 2019, pp. 65-78.
[16]
Tobias Mayer. »Umstrittene Präfiguration. Politische und theologische Typologie in einem Nachlassfragment Hans Blumenbergs.« Alles egal? Theologische Reflexionen zur Gleichgültigkeit. Herausgegeben von Alexander Gaderer, Barbara Lumesberger-Loisl und Teresa Schweighofer. Herder, 2015, pp. 111-23.
[17]
Khosrow Nosratian. »In der Beletage der freischwebenden Intelligenz. Über Hans Blumenberg.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 54. Jahrgang, Heft 619, November 2000, pp. 1120-5.
[18]
Annette Vowinckel. »›Ich fürchte mich vor den Organisationslustigen.‹ Ein Dialog zwischen Hans Blumenberg und Reinhart Koselleck.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 68. Jahrgang, Heft 781, Juni 2014, pp. 546-50.
[19]
Hans Blumenberg. Die nackte Wahrheit. Herausgegeben von Rüdiger Zill. Suhrkamp, 2019.
[21]
Ernst Ziegler. »Schopenhauer und Spinoza.« Aufklärung und Kritik. Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie. Herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg. Sonderdruck. 27. Jahrgang, 2/2020.
[22]
Charles Peterson. »Serfs of Academe.« The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 4, March 12, 2020, pp. 42-5.
[23]
Samantha Ashenden und Andreas Hess. »The theorist of belonging.« Aeon, March 16, 2020, https://aeon.co/essays/discovering-judith-shklars-skeptical-liberalism-of-fear.
[24]
Tim Wu. »Bigger Brother.« Rezension zu The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, von Shoshana Zuboff. The New York Review of Books, April 9, 2020, vol. LXVII, no. 6, pp. 18-9.
[25]
Justin E. H. Smith. »It’s All Just Beginning.« The Point, March 23, 2020, https://thepointmag.com/examined-life/its-all-just-beginning/.
[26]
Eric Jager. »The Woman in Black. The last judicial duel in France hinged on whether a woman could be believed.« Lapham’s Quarterly, vol. XIII, no. 2, Spring 2020, https://www.laphamsquarterly.org/scandal/woman-black.
[27]
Joseph Epstein. »Learning Latin.« First Things, April 2020, https://www.firstthings.com/article/2020/04/learning-latin.
[28]
Massimo Pigliucci. »The perils of knowledge in a pandemic.« The Institute of Arts and Ideas, Issue 87, 31st March 2020, https://iai.tv/articles/the-perils-of-knowledge-in-a-pandemic-auid-1392.
[29]
Francis Eanes und Eleni Schirmer. »For Higher Education, a ›Return to Normal‹ Isn’t Good Enough.« Jacobin, 04.04.2020, https://jacobinmag.com/2020/04/for-higher-education-a-return-to-normal-isnt-good-enough/.
[30]
P. D. Smith. »Relative values. The private and public lives of Albert Einstein.« The Times Literary Supplement, April 3, 2020, https://www.the-tls.co.uk/articles/the-public-and-private-lives-of-albert-einstein-p-d-smith/.
[31]
Evelyne v. Beyme. Lerntheorien III: Das Lernen lernen. Lernstrategien und Metakognition. Seminararbeit, U Zürich, Frühjahrssemester 2020.
[32]
Evelyne v. Beyme. Unterrichtsentwurf zu Paul Celans «Todesfuge». Seminararbeit, U Zürich, Frühjahrssemester 2020.
[33]
Richard Bratby. »The marvel of Mozart’s letters.« The Spectator, 18 April 2020, https://www.spectator.co.uk/article/the-marvel-of-mozart-s-letters.
[34]
Herfried Münkler. »Hegel und wir.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 5-13.
[35]
Jürgen Kaube. »Logik eines Satzes.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 14-26.
[36]
Benjamin Taylor. »Philip Roth’s Terrible Gift of Intimacy.« The Atlantic, May 2020, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/05/being-friends-with-philip-roth/609106/.
[37]
Hermann Hesse. »Bericht aus Normalien. Fragment.« Die Erzählungen 1911-1954. Suhrkamp, 2001, pp. 438-48. Sämtliche Werke, herausgegeben von Volker Michels, Bd. 8, Die Erzählungen 3.
[38]
Terry Pinkard. »Revolution und noch kein Ende.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 27-38.
[39]
Judith Butler. »Warum jetzt Hegel lesen[?]« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 39-56.
[40]
Susan Tallman. »The Master of Unknowing.« The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 8, May 14, 2020, pp. 4-8.
[41]
Eef Overgaauw und Michael Matthiesen. »Der Nachlass und die verlorenen Briefe.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 57-72.
[42]
Carlos Spoerhase. »Ein Weltpreis für Karl Jaspers. Hannah Arendt, Klaus Piper und der Nobelpreis.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 98-111.
[43]
Brianna Rennix: »The Politics and ›Pretentiousness‹ of Reading James Joyce.« Current Affairs, 28 April 2020, https://www.currentaffairs.org/2020/04/the-politics-and-pretentiousness-of-reading-james-joyce.
[44]
Ulrich Rudolph. »Der philosophische Diskurs in der islamischen Welt.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 112-8.
[45]
Harald Weinrich. Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. Beck, 1997.
[46]
Tom Lamont. »Can we escape from information overload?« The Economist: 1843 Magazine, May 6th 2020, https://www.1843magazine.com/features/can-we-escape-from-information-overload.
[47]
Siegfried Unseld. Goethe und der Ginkgo. Ein Baum und ein Gedicht. 9. Aufl., Insel, 1999.
[48]
Alexander Larman. »The oldest rockers in town. The original generation of rock ‘n’ rollers remain more interesting than modern stars.« The Critic, 27 April 2020, https://thecritic.co.uk/the-oldest-rockers-in-town/.
[49]
Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2018. Gesamtausgabe Bd. 5, herausgegeben von Walter Fanta.
[50]
Ray Monk. »Wittgenstein’s self-isolation.« Standpoint, 22 May 2020, https://standpointmag.co.uk/issues/may-june-2020/wittgensteins-self-isolation/.
[51]
Felix Heidenreich. Politische Metaphorologie. Hans Blumenberg heute. Metzler/Springer, 2020.
[52]
Annie Ernaux. Eine Frau. Aus dem Französischen von Sonja Finck. Suhrkamp, 2019.
[53]
Claudia Mäder. »Es ist Zeit, einen neuen Blick auf Simone de Beauvoir zu werfen.« Rezension zu Simone de Beauvoir. Ein modernes Leben, von Kate Kirkpatrick. Neue Zürcher Zeitung, 08.06.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/simone-de-beauvoir-ist-dank-kate-kirkpatricks-neu-zu-entdecken-ld.1559813.
[54]
Rüdiger Görner. London, querstadtein. Vieldeutige Liebeserklärungen. Corso, 2014.
[55]
Franz Josef Wetz. »Radikaler Kritiker der Moderne – Der Philosoph Hans Blumenberg.« SWR2 Wissen: Aula, 11. Juni 2020, https://www.swr.de/swr2/wissen/radikaler-kritiker-der-moderne-der-philosoph-hans-blumenberg-swr2-wissen-aula-2020-06-11-100.html.
[56]
Amanda Mull. »The End of Minimalism.« The Atlantic, July/August 2020, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/07/the-triumph-of-the-slob/612232/.
[57]
Susan Sontag und Jonathan Cott. The Doors und Dostojewski. Das Rolling-Stone_-Interview._ Aus dem Englischen von Georg Deggerich. Hoffmann und Campe, 2014.
[58]
Douglas Brinkley. »Bob Dylan Has a Lot on His Mind.« The New York Times, June 12, 2020, https://www.nytimes.com/2020/06/12/arts/music/bob-dylan-rough-and-rowdy-ways.html.
[59]
David Rieff. Tod einer Untröstlichen. Die letzten Tage von Susan Sontag. Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser. Hanser, 2009.
[60]
Danny Heitman. »A Monument to the Mother Tongue.« Humanities. The Magazine of the National Endowment for the Humanities, Spring 2020, Volume 41, Number 2, https://www.neh.gov/article/monument-mother-tongue.
[61]
Maria Behre. »Umkehrung der Blickrichtung: LehrerIn werden. SchülerIn sein. Erinnerungen an Hans Blumenbergs Münsteraner Zeit, inspiriert durch Uwe Wolffs brillantes Buch ›Der Schreibtisch des Philosophen‹.« literaturkritik.de, 18.06.2020, [literaturkritik.de/public/re….
[62]
Philip Roth. Täuschung. Roman. Aus dem Amerikanischen von Jörg Trobitius. Hanser, 1993.
[63]
Pardis Dabashi. »Rise of the Absurdly Demanding Job Ad. Enough with peculiar obscurantism and unreasonable expectations.« The Chronicle of Higher Education, June 4, 2020, [www.chronicle.com/article/R….
[64]
Uwe Wolff. »Blumenbergs Engel.« Herder Korrespondenz. Monatsheft für Gesellschaft und Religion, 74. Jahrgang, Juli 2020, pp. 46-8.
[65]
Katharina Sykora. »Hier führte sie das Wort. Erika Mann in Amerika.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.06.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/erika-mann-in-amerika-hier-fuehrte-sie-das-wort-16834158.html.
[66]
Thomas Sören Hoffmann. »Ein Staat, dem die Bürger nicht mehr vertrauen, ist am Ende – nähern wir uns diesem Zustand?« Neue Zürcher Zeitung, 29.06.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/hegel-und-das-corona-jahr-wie-sich-staat-und-buerger-entfremden-ld.1562691.
[67]
Julian Baggini. »Not all slopes are slippery. How to decide which statues can remain and which need to go.« The Times Literary Supplement, https://www.the-tls.co.uk/articles/not-all-slopes-are-slippery/.
[68]
Rachel Fraser. »Illness as Fantasy.« The Point, June 12, 2020, https://thepointmag.com/criticism/illness-as-fantasy/.
[69]
Katja Behling. »Der Metapher verpflichtet.« tachles. Das jüdische Wochenmagazin, 03. Jul 2020, https://www.tachles.ch/artikel/kultur/der-metapher-verpflichtet.
[71]
George Blaustein. »Searching for Consolation in Max Weber’s Work Ethic.« The New Republic, July 2, 2020, https://newrepublic.com/article/158349/searching-consolation-max-webers-work-ethic.
[72]
Dalya Alberge. »Top director to shoot biopic about Beatles manager Brian Epstein.« The Guardian, 2 Jul 2020, https://www.theguardian.com/film/2020/jul/02/top-director-jonas-akerlund-to-shoot-biopic-about-beatles-manager-brian-epstein.
[73]
Bernd Noack. »Eine Geste mit grosser Wirkung: Wer beim Lesen unterbrochen wird, steckt seinen Finger ins Buch.« Rezension zu Der Finger im Buch. Die unterbrochene Lektüre im Bild, von Ulrich Johannes Schneider. Neue Zürcher Zeitung, 06.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/den-finger-ins-buch-gelegt-und-die-lektuere-unterbrochen-ld.1563976.
[74]
Jochen Zenthöfer. »Doktortitel der Berliner ›Blockchain Queen‹ widerrufen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/plagiate-doktortitel-der-berliner-blockchain-queen-widerrufen-16848307.html.
[75]
Ingrid D. Rowland. »He Made Stone Speak.« Rezension zu Michelangelo, God’s Architect: The Story of His Final Years and Greatest Masterpiece, von William E. Wallace. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 8-12.
[76]
Carl Elliott. »An Ethical Path to a Covid Vaccine.« Rezension zu Adverse Events: Race, Inequality, and the Testing of New Pharmaceuticals, von Jill A. Fisher. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 18-21.
[77]
Christopher R. Browning. »Who Resisted the Nazis?« Rezension zu The Resistance in Western Europe, 1940–1945, von Olivier Wieviorka; Sudden Courage: Youth in France Confront the Germans, 1940–1945, von Ronald C. Rosbottom; Defying Hitler: The Germans Who Resisted Nazi Rule, von Gordon Thomas und Greg Lewis, sowie Last Letters: The Prison Correspondence, September 1944–January 1945, von Freya und Helmuth James von Moltke. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 24-6.
[78]
Jonathan Zimmerman. »What Is College Worth?« Rezension zu The College Dropout Scandal, von David Kirp; The Impoverishment of the American College Student, von James V. Koch; Lower Ed: The Troubling Rise of For-Profit Colleges in the New Economy, von Tressie McMillan Cottom; The Years That Matter Most: How College Makes or Breaks Us, von Paul Tough, sowie Indebted: How Families Make College Work at Any Cost von Caitlin Zaloom. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 36-8.
[79]
Andreas Platthaus. »Elke Erb erhält Büchnerpreis 2020.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/elke-erb-erhaelt-georg-buechnerpreis-2020-16849656.html.
[80]
Hans Zippert. »Solo für keinen. Ringo Starr zum 80. Geburtstag.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/beatles-schlagzeuger-ringo-starr-zum-80-geburtstag-16848575.html.
[81]
Elizabeth A. Harris. »Simon & Schuster Names Dana Canedy New Publisher.« The New York Times, July 6, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/06/books/dana-canedy-named-simon-schuster-publisher.html.
[82]
Andreas Kilb. »Das Kino spielte seine Melodie. Komponist Morricone gestorben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/zum-tode-des-filmkomponisten-ennio-morricone-16848706.html.
[83]
Paul Ingendaay. »Schlimme Tage in Scharbeutz. Urlaub mit Heinrich Heine.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/sommerurlaub-in-deutschland-mit-heinrich-heine-16847002.html.
[84]
Robyn Creswell. »Making and Unmaking.« Rezension zu The Ruins Lesson: Meaning and Material in Western Culture, von Susan Stewart. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 41-2.
[85]
Uwe Wolff. »Licht aus der Mitte.« Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 9. Juli 2020, p. 21.
[86]
Jessica Riskin. »Just Use Your Thinking Pump!« Rezension zu The Scientific Method: An Evolution of Thinking from Darwin to Dewey, von Henry M. Cowles. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 48-50.
[87]
Heinrich Niehues-Pröbsting. »Auch im Tod blieb er unsichtbar: Der Philosoph Hans Blumenberg wollte nur durch sein Werk wirken, selbst Bilder gibt es von ihm kaum.« Neue Zürcher Zeitung, 13.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/unsichtbar-bis-in-den-tod-zu-hans-blumenbergs-100-geburstag-ld.1565040.
[88]
Maria Behre. »Arbeit am Begriff der Wirklichkeit. Zu Hans Blumenbergs Konvolut ›Realität und Realismus‹, aus dem Nachlass herausgegeben von Nicola Zambon.« literaturkritik.de, 13.07.2020, https://literaturkritik.de/blumenberg-realitaet-und-realismus-arbeit-am-begriff-der-wirklichkeit,26957.html.
[89]
Otfried Höffe. »War Kant ein Rassist?« Neue Zürcher Zeitung, 15.07.2020, https://www.nzz.ch/amp/meinung/war-kant-ein-rassist-ld.1562781.
[90]
Michael Powell. »How a Famous Harvard Professor Became a Target Over His Tweets.« The New York Times, July 15, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/15/us/steven-pinker-harvard.html.
[91]
Slavoj Žižek. »Die Epidemie hat die Ökologie begraben: Aber hängen die beiden Fragen (und auch jene nach dem Rassismus) doch zusammen?« Neue Zürcher Zeitung, 18.06.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/slavoj-zizek-epidemie-oder-oekologie-oder-rassismus-falsch-ld.1561473.
[92]
Keith Thomas. »Noisomeness.« Rezension zu Smells: A Cultural History of Odours in Early Modern Times, von Robert Muchembled, sowie The Clean Body: A Modern History, von Peter Ward. London Review of Books, vol. 42, no. 14, 16 July 2020, https://lrb.co.uk/the-paper/v42/n14/keith-thomas/noisomeness.
[93]
Heimo Schwilk. »Denkrätsel des Philosophen.« Rezension zu Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg, von Uwe Wolff. Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 9. Juli 2020, p. 24.
[94]
Stephan Sahm. »Bioethik mit Kante. Eberhard Schockenhoff ist tot.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bioethik-mit-kante-zum-tode-von-eberhard-schockenhoff-16867603.html.
[95]
Andreas Urs Sommer. »Ich widerspreche, wie nie widersprochen worden ist.« Rezension zu »Ich bin Dynamit«. Das Leben des Friedrich Nietzsche, von Sue Prideaux, sowie »Nietzsches Vermächtnis«. ›Ecce homo‹ und ›Der Antichrist‹. Zwei Bücher über Natur und Politik, von Heinrich Meier. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/neue-buecher-ueber-friedrich-nietzsche-von-sue-prideaux-und-heinrich-meier-16838636.html.
[96]
Ruchir Sharma. »Which Country Will Triumph in the Post-Pandemic World?« The New York Times, July 19, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/19/opinion/coronavirus-germany-economy.html.
[97]
Katharine Q. Seelye. »John Lewis, Towering Figure of Civil Rights Era, Dies at 80.« The New York Times, July 17, 2020, updated July 20, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/17/us/john-lewis-dead.html.
[98]
Ben Beaumont-Thomas. »Emitt Rhodes, influential US psych-pop musician, dies aged 70.« The Guardian, 20 Jul 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/jul/20/emitt-rhodes-influential-us-psych-pop-musician-dies-aged-70.
[99]
Mark Mazower. »Clear, Inclusive, and Lasting.« Rezension zu Eric Hobsbawm: A Life in History, von Richard J. Evans, sowie Meet Me in Buenos Aires: A Memoir, von Marlene Hobsbawm. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 12, July 23, 2020, pp. 42-44.
[100]
Agnes Callard. »Should We Cancel Aristotle?« The New York Times, July 21, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/should-we-cancel-aristotle.html.
[101]
Max Nyffeler. »Händels Zorn. Neuer Podcast Barock@Home.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/der-podcast-barock-home-hat-vorbildcharakter-16869097.html.
[102]
Till Kinzel. Rezension zu Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg, von Uwe Wolff. Informationsmittel (IFB). Digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, [17. Juli 2020?], [www.informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile…..
[103]
Ewa Trutkowski. »Vom Gendern zu politischen Rändern.« Neue Zürcher Zeitung, 22.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/gendergerechte-sprache-die-diskussion-ist-politisch-vergiftet-ld.1567211.
[104]
Marcos Balter. »His Name Is Joseph Boulogne, Not ›Black Mozart‹.« The New York Times, July 22, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/22/arts/music/black-mozart-joseph-boulogne.html.
[105]
Thomas Steinfeld. »Das unfassbare Tier.« Rezension zu Auf den Spuren des Wals. Geographien des Lebens im 19. Jahrhundert, von Felix Lüttge. Süddeutsche Zeitung, 22. Juli 2020, https://www.sueddeutsche.de/kultur/geographien-des-lebens-im-19-jahrhundert-das-unfassbare-tier-1.4975311.
[106]
The Editorial Board. »The Hagia Sophia Was a Cathedral, a Mosque and a Museum. It’s Converting Again.« The New York Times, July 22, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/22/opinion/hagia-sophia-mosque.html.
[107]
Maya Jasanoff. »The Future Was His.« Rezension zu Inventing Tomorrow: H.G. Wells and the Twentieth Century, von Sarah Cole. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 12, July 23, 2020, pp. 50-1.
[108]
Helmut Glück. »Der neue Umbennungsfuror.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/debatte-um-begriff-mohr-der-neue-umbennungsfuror-16872089.html.
[109]
Sian Cain. »Why a generation is choosing to be child-free.« The Guardian, 25 Jul 2020, https://www.theguardian.com/books/2020/jul/25/why-a-generation-is-choosing-to-be-child-free.
[110]
Charles McNamara. »Minds Stocked Only with Opinions.« Rezension zu Lost in Thought. The Hidden Pleasures of an Intellectual Life, von Zena Hitz. Commonweal, July 23, 2020, https://www.commonwealmagazine.org/minds-stocked-only-opinions.
[111]
Stefan Trinks. »Sie nannten ihn den Gott der Maler. Rubensaustellung in Paderborn.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/der-gott-der-maler-rubens-schau-im-paderborner-dioezesanmuseum-16874714.html.
[112]
Gerald Felber. »Zuhören, zuschauen und einfach abheben. Kinofilm über Anton Bruckner.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/dokumentarfilm-anton-bruckner-das-verkannte-genie-im-kino-16874794.html.
[113]
Jochen Hieber. »Der Höhepunkt des Hölderlinjahrs. Frankfurter Ausgabe.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/frankfurter-ausgabe-der-saemtlichen-werke-hoelderlins-16874789.html.
[114]
Blake Smith. »Stanley Fish and the Argument Against Free Speech.« Tablet Magazine, July 21, 2020, https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/cancel-culture-stanley-fish-free-speech.
[115]
Morten Høi Jensen. »How Should One Live?« Rezension zu Philosopher of the Heart: The Restless Life of Søren Kierkegaard, von Claire Carlisle. The American Interest, July 26, 2020, https://www.the-american-interest.com/2020/07/26/how-should-one-live/.
[116]
Daniele Muscionico. »Die unverschämte Leichtigkeit des Rassismusvorwurfes.« Neue Zürcher Zeitung, 27.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/martin-parr-die-unverschaemte-leichtigkeit-des-rassismus-vorwurfs-ld.1568424.
[117]
Wolfgang Matz. »Eine intellektuelle Schlüsselfigur des zwanzigsten Jahrhunderts.« Rezension zu »Von Berlin nach Jerusalem und zurück«. Gershom Scholem zwischen Israel und Deutschland, von Noam Zadoff. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/noam-zadoffs-buch-von-berlin-nach-jerusalem-und-zurueck-ueber-gershom-scholem-16864040.html.
[119]
Andreas Platthaus. »Stolze Pflicht des Enkelseins. Frido Mann wird 80.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/dem-schriftsteller-frido-mann-zum-80-geburtstag-16883128.html.
[121]
»Tilman Jens ist tot.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/streitbarer-publizist-tilman-jens-ist-tot-16888031.html.
[122]
Andrew Sullivan. »See You Next Friday: A Farewell Letter.« New York, July 17, 2020, https://nymag.com/intelligencer/2020/07/andrew-sullivan-see-you-next-friday.html.
[123]
Justus Bender. »Junge Linke gegen alte Linke.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/identitaetspolitik-das-problem-des-linksliberalismus-16884379.html.
[124]
Jochen Zenthöfer. »Berliner Gericht verschärft Zitierregeln.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/plagiate-berliner-gericht-verschaerft-zitierregeln-16889827.html.
[125]
Jonah Engel Bromwich und Ezra Marcus. »The Anonymous Professor Who Wasn’t.« The New York Times, Aug 4, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/04/style/college-coronavirus-hoax.html.
[126]
Marcel Schütz. »Eine abgesagte Affäre: Der Fall Philipp Amthor und das übliche Spiel der politischen Radikalen.« Neue Zürcher Zeitung, 05.08.2020, https://www.nzz.ch/meinung/fall-philipp-amthor-das-uebliche-spiel-der-politischen-radikalen-ld.1568844.
[127]
Burkhardt Wolf. »Sein und Scheitern. Zur Metakinetik des Schiffs.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 5-20.
[128]
»5 Minutes That Will Make You Love 21st-Century Composers.« The New York Times, Aug. 5, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/05/arts/music/five-minutes-classical-music.html.
[129]
Bill McKibben. »130 Degrees.« Rezension zu Our Final Warning: Six Degrees of Climate Emergency, von Mark Lynas. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 13, August 20, 2020, pp. 8-10.
[130]
Dalya Alberge. »Intimate letters reveal Simone de Beauvoir’s role as an agony aunt.« The Guardian, 9 Aug 2020, https://www.theguardian.com/books/2020/aug/09/intimate-letters-reveal-simone-de-beauvoirs-role-as-an-agony-aunt.
[131]
Jeffrey J. Williams. »The Rise of the Promotional Intellectual.« The Chronicle of Higher Education, August 5, 2018, https://www.chronicle.com/article/the-rise-of-the-promotional-intellectual/.
[132]
Dominic Green. »John Coltrane and the End of Jazz.« Washington Examiner, August 26, 2018, https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/john-coltrane-and-the-end-of-jazz.
[133]
Rainer Stamm. »Schifffahrt aus drei Perspektiven.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/ernst-juengers-atlantische-fahrt-aus-drei-perspektiven-16894893.html.
[134]
Andreas Bähr. »Wissenschaft auf Umwegen. Athanasius Kirchers Schiffbruch.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 21-30.
[135]
Claudia Mäder. »Blablabla.« Neue Zürcher Zeitung, 10.08.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/managementsprech-wieso-nehmen-wir-diese-hohlen-phrasen-ernst-ld.1569984.
[136]
Lotte Thaler. »Altersweise? Von wegen! Beethovens Streichquartette.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/das-quatuor-ebene-spielt-beethovens-streichquartette-16897167.html.
[137]
Marie Lisa Kehler. »Wie schwer eine Corona-Infektion das Herz schädigen kann.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html.
[138]
Jochen Zenthöfer. »Disziplinarverfahren gegen Cornelia Koppetsch.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/plagiate-disziplinarverfahren-gegen-soziologin-koppetsch-16899925.html.
[139]
Jonathan Sheehan. »Der Stil des Spinozismus. Über ein offenes Geheimnis in der Moderne.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 53-66.
[140]
Tobias Rüther. »Nostalgische Tweetparade. ›Listening Parties‹.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/tim-burgess-und-seine-listening-parties-auf-twitter-16894344.html.
[141]
Bernhard Pörksen. »Meinen und Behaupten in unserer Zeit – Über den Wirklichkeitsverlust polemisierender Grosstheoretiker.« Neue Zürcher Zeitung, 12.08.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/die-polemisierende-kulturkritik-leidet-unter-wirklichkeitsverlust-ld.1570515.
[143]
Philip Plickert. »Vergiftetes Klima an britischen Universitäten. Kult der Korrektheit.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/kult-der-korrektheit-vergiftetes-klima-an-britischen-universitaeten-16899316.html.
[144]
Arielle Pardes. »How Facebook and Other Sites Manipulate Your Privacy Choice.« Wired, 08.12.2020, https://www.wired.com/story/facebook-social-media-privacy-dark-patterns/.
[145]
Christina Kunkel. »Rätselraten um den Nutzen der Corona-App.« Süddeutsche Zeitung, 15. August 2020, https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-app-warnung-covid-risiko-downloads-rki-1.4998898.
[146]
Davey Alba. »Debunking 3 Viral Falsehoods About Kamala Harris.« The New York Times, Aug. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/14/technology/kamala-harris-disinformation.html.
[147]
Maria Behre. »Der Mensch vor dem Meer der Metaphern. Blick auf Blumenbergs Bedeutsamkeit – Rüdiger Zills Biographie.« literaturkritik.de, 14.08.2020, https://literaturkritik.de/zill-absolute-leser-mensch-vor-meer-metaphern-blick-auf-blumenbergs-bedeutsamkeit-ruediger-zills-biographie,27059.html.
[148]
Daniel Kreps. »Liverpool’s Cavern Club ›Could Close Forever‹ Due to Covid-19 Impact.« Rolling Stone, August 15, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/liverpool-cavern-club-close-forever-covid-19-impact-1045104/.
[149]
Michael Powell. »A Black Marxist Scholar Wanted to Talk About Race. It Ignited a Fury.« The New York Times, Aug. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/14/us/adolph-reed-controversy.html.
[150]
Marie-Astrid Langer. »Joe Biden ist nun offiziell der Kandidat der Demokraten im Rennen um das Weisse Haus – und sogar Republikaner werben für ihn.« Neue Zürcher Zeitung, 19.08.2020, https://www.nzz.ch/international/joe-biden-ist-nun-offiziell-der-kandidat-der-us-demokraten-ld.1572064.
[151]
John Gruber. »On TikTok as a Security Threat.« Daring Fireball, 18 August 2020, https://daringfireball.net/2020/08/on_tiktok_as_a_security_threat.
[152]
Kevin Roose. »What Is QAnon, the Viral Pro-Trump Conspiracy Theory?« The New York Times, Aug. 18, 2020, https://www.nytimes.com/article/what-is-qanon.html.
[153]
Paul Berman. »Lynching and Liberalism.« Tablet, August 17, 2020, https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/liberalism-harpers-letter-dewey.
[154]
Hans Blumenberg. Realität und Realismus. Herausgegeben von Nicola Zambon. Suhrkamp, 2020.
[155]
Paul Ingenadaay. »Vom Werden einer Weltmacht. John Dos Passos’ USA-Trilogie in neuer Übersetzung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/john-dos-passos-usa-trilogie-in-neuer-uebersetzung-16898695.html.
[156]
Katja Winter. »›Verbeugung vor der Fortschrittlichkeit der Mauren.‹ Nach Kritik an Apotheken-Name.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/ist-mohr-rassistisch-eine-apothekerin-wehrt-sich-16917954.html.
[157]
Penelope Green. »Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez’s Wife and Muse, Dies at 87.« The New York Times, Aug. 23, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/23/books/mercedes-barcha-dead.html.
[158]
Uwe Wolf. Agnes Miegel und das Leben in Quarantäne. Mit einem Beitrag von Archimandrit Irenäus Totzke. Arnshaugk, 2020.
[159]
Nina Jerzy. »Der unbequeme, aber ewige James Bond: Sean Connery wird 90.« Neue Zürcher Zeitung, 25.08.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/der-unbequeme-aber-ewige-james-bond-sean-connery-wird-90-ld.1571228.
[160]
Kory Grow. »John Lennon’s Solo Work Gets Upgraded for New Box Set.« Rolling Stone, August 26, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/john-lennon-gimme-some-truth-box-set-1049807/.
[161]
Claire Shaffer. »John Lennon’s Killer Mark David Chapman Denied Parole for 11th Time.« Rolling Stone, August 26, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/john-lennon-mark-david-chapman-denied-parole-11th-time-1050323/.
[162]
Carl Schmitt. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. 10. Aufl., Klett-Cotta, 2020.
[163]
Alex Marshall. »The British Museum Reopens to a World That Has Changed.« The New York Times, Aug. 27, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/27/arts/design/british-museum-reopening.html.
[165]
Cheryl Misak. »Frank Ramsey: A more human philosophy.« The Times Literary Supplement, https://www.the-tls.co.uk/articles/frank-ramsey-a-more-human-philosophy/.
[166]
Dylan J. Montanari. »An Alternative Common Sense: Notes on Carlo Michelstaedter’s Philosophy.« Rezension zu The Wreckage of Philosophy: Carlo Michelstaedter and the Limits of Bourgeois Thought, von Mimmo Cangiano. Los Angeles Review of Books, August 24, 2020, https://lareviewofbooks.org/article/an-alternative-common-sense-notes-on-carlo-michelstaedters-philosophy/.
[167]
Melanie Möller. »Arbeit am Abstand. 100 Jahre Hans Blumenberg.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 122-6.
[168]
Stefan Zweig. Angst. Novelle. Herausgegeben von Michael Scheffel. 4., durchgesehene Aufl., Reclam, 2013.
[169]
Daniele Muscionico. »Selbstzensur oder Pornografie? – Weshalb die neuen Sittenwächter eine Unsitte sind. Und warum gerade das, was uns verstört, nicht weg darf.« Neue Zürcher Zeitung, 01.09.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/selbstzensur-oder-pornografie-warum-die-neuen-sittenwaechter-eine-alte-unsitte-sind-ld.1573889.
[170]
Zach Baron. »The Conscience of Silicon Valley.« GQ, August 24, 2020, https://www.gq.com/story/jaron-lanier-tech-oracle-profile.
[171]
Jenni Thier. »Die ›beste Corona-App‹ ist auf dem Boden der Realität angekommen.« Neue Zürcher Zeitung, 02.09.2020, https://www.nzz.ch/technologie/die-beste-corona-app-ist-auf-dem-boden-der-realitaet-angekommen-ld.1574541.
[172]
Tyler Cowen. »No, America Will Not Be Canceled.« Bloomberg, 1. September 2020, [www.bloomberg.com/opinion/a….
[173]
[»John Cleese Intends to Have His Unread Books Buried With Him.« The New York Times, Sept. 3, 2020, www.nytimes.com/2020/09/0…](https://denkkerker.com/2020/09/04/jenseitige-lekture/).
[174]
Ben Rothenberg. »Why Was Novak Djokovic Disqualified From the U.S. Open?« The New York Times, Sept. 6, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/06/sports/tennis/us-open-disqualification-defaulted-djkovic.html.
[175]
Hua Hsu. »How Can We Pay for Creativity in the Digital Age?« The New Yorker, September 7, 2020, https://www.newyorker.com/magazine/2020/09/14/how-can-we-pay-for-creativity-in-the-digital-age.
[176]
Axel Weidemann. »Maskenball der Supertrolle.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/maskenball-der-supertrolle-die-2-staffel-von-the-boys-16938537.html.
[177]
Jenni Thier. »Das Internet, wie wir es kennen, ist in Gefahr – und Europa darf nicht tatenlos zuschauen.« Neue Zürcher Zeitung, 09.09.2020, https://www.nzz.ch/meinung/europa-muss-aktiv-werden-um-das-freie-internet-zu-schuetzen-ld.1575357.
[178]
Patricia Morrisroe. »The Black Violinist Who Inspired Beethoven.« The New York Times, Sept. 4, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/04/arts/music/george-bridgetower-violin.html.
[179]
Arielle Pardes. »Hate Social Media? You’ll Love This Documentary.« Wired, 09.09.2020, https://www.wired.com/story/social-dilemma-netflix-documentary/.
[180]
Max Read. »Going Postal. A psychoanalytic reading of social media and the death drive.« Rezension zu The Twittering Machine, von Richard Seymour. Bookforum, https://www.bookforum.com/print/2703/a-psychoanalytic-reading-of-social-media-and-the-death-drive-24171.
[181]
Michael Levenson. »Professor Investigated for Posing as Black Has Resigned, University Says.« The New York Times, Sept. 9, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/09/us/jessica-krug-george-washington-university.html.
[182]
Patrick Bahners. »Wer passt, wird passend gemacht.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/die-sogenannten-hausberufungen-der-universitaet-halle-16942870.html.
[183]
Markus Steinmayr. »Das große Ganze und dessen Reform.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/blumenberg-und-die-universitaet-das-grosse-ganze-und-dessen-reform-16942877.html.
[184]
Sara Aridi. »How to Declutter Your Digital World.« The New York Times, Sept. 12, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/12/at-home/declutter-your-digital-world.html.
[185]
Thomas Thiel. »Die Revolution wird nicht auf Twitter stattfinden.« Rezension zu »The Coming of Neo-Feudalism«. A Warning to the Global Middle Class, von Joel Kotkin. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/joel-kotkins-buch-the-coming-of-neo-feudalism-16898698.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
[186]
Kory Grow. »Abbey Road Studios Shut Down for the First Time in 89 Years. Now, It’s Thriving.« Rolling Stone, September 15, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-features/abbey-road-idles-interview-1057309/.
[187]
Robert D. McFadden. »Bill Gates Sr., Who Guided Billionaire Son’s Philanthropy, Dies at 94.« The New York Times, Sept. 15, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/15/business/bill-gates-sr-dead.html.
[188]
Sonja Jordans. »Mitteilsame Messenger-Dienste.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/mitteilsame-messenger-dienste-wie-privatsphaere-wahren-16956490.html.
[189]
Alexandra Alter. »He Invented the Rubik’s Cube. He’s Still Learning From It.« The New York Times, Sept. 16, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/16/books/erno-rubik-rubiks-cube-inventor-cubed.html.
[190]
Ben Beaumont-Thomas. »The Beatles announce Get Back, first official book in 20 years.« The Guardian, 16 Sep 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/sep/16/the-beatles-announce-get-back-first-official-book-in-20-years.
[191]
Steven Kurutz. »Winston Groom, Author of ›Forrest Gump,‹ Dies at 77.« The New York Times, Sept. 18, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/18/books/winston-groom-dead-forrest-gump.html.
[192]
Linda Greenhouse. »Ruth Bader Ginsburg, Supreme Court’s Feminist Icon, Is Dead at 87.« The New York Times, Sept. 18, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/18/us/ruth-bader-ginsburg-dead.html.
[193]
Bob Woodward und Richard Barenberg. Furcht. Trump im Weißen Haus. Ungekürzte Lesung. Rowohlt und Argon, 2018.
[194]
Kathryn Hughes. »Bliss in That Dawn.« Rezension zu Radical Wordsworth: The Poet Who Changed the World, von Jonathan Bate; The Making of Poetry: Coleridge, the Wordsworths, and Their Year of Marvels, von Adam Nicolson, sowie William Wordsworth: A Life, von Stephen Gill. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 14, September 24, 2020, pp. 51-3.
[195]
Peter Brown. »No Barbarians Necessary.« Rezension zu The Tragedy of Empire: From Constantine to the Destruction of Roman Italy, von Michael Kulikowski; Escape from Rome: The Failure of Empire and the Road to Prosperity, von Walter Scheidel, sowie King and Emperor: A New Life of Charlemagne, von Janet L. Nelson. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 14, September 24, 2020, pp. 61-2.
[196]
Leah Price. »Page-Turners.« Rezension zu Inky Fingers: The Making of Books in Early Modern Europe, von Anthony Grafton, sowie When Novels Were Books, von Jordan Alexander Stein. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 14, September 24, 2020, pp. 65-6.
[197]
Thomas Ribi. »Bitte keine Kritik, wir sind eine Hochschule! Wie Wissenschaftskommunikation zu Imagepflege wird – und warum.« Rezension zu Forschung in der Filterblase. Die Wissenschaftskommunikation der Schweizer Hochschulen in der digitalen Ära, von Urs Hafner. Neue Zürcher Zeitung, 21.09.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/wissenschaft-und-oeffentlichkeit-imagepflege-statt-information-ld.1577417.
[198]
John Voorhees. »Widgets and a New Sidebar Design Make Anybuffer a Standout Among Clipboard Managers.« MacStories, Sep 21, 2020, https://www.macstories.net/reviews/widgets-and-a-new-sidebar-design-make-anybuffer-a-standout-among-clipboard-managers/.
[199]
Eric L. Motley. »My Unlikely Friendship With Ruth Bader Ginsburg.« The New York Times, Sept. 21, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/21/opinion/ruth-bader-ginsburg-friendship.html.
[200]
Tim Nahumck. »Drafts 22 Review: Widgets, Scribble, and More.« MacStories, Sep 22, 2020, https://www.macstories.net/reviews/drafts-22-review-widgets-scribble-and-more/.
[201]
Jon Blistein. »Sean Lennon to Interview Paul McCartney, Elton John for ›John Lennon at 80‹ Special.« Rolling Stone, September 23, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/sean-lennon-john-lennon-elton-john-paul-mccartney-radio-special-1065304/.
[202]
Evan Goldstein und Jill Lepore. »Higher Ed Has a Silicon Valley Problem. Jill Lepore on how algorithms came to supersede art, and the distorting effects of money in academe.« The Chronicle of Higher Education, September 23, 2020, https://www.chronicle.com/article/higher-ed-has-a-silicon-valley-problem.
[203]
Heinrich Niehues-Pröbsting. »Über meinen Lehrer Hans Blumenberg.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 24. September 2020, https://www.merkur-zeitschrift.de/2020/09/24/ueber-meinen-lehrer-hans-blumenberg/.
[204]
Erdmut Wizisla. »War es die reine Häme?« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/walter-benjamins-todesnachricht-im-stuermer-16971233.html.
[205]
Eduard Kaeser. »Unsere Wege schneiden und verwickeln sich überall und jederzeit – ein neuer Existenzialismus in ansteckenden Zeiten.« Neue Zürcher Zeitung, 28.09.2020, https://www.nzz.ch/meinung/corona-ein-neuer-existenzialismus-in-ansteckenden-zeiten-ld.1575017.
[206]
»Armenien und Aserbaidschan im Kriegszustand.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nagornyj-karabach-armenien-und-aserbaidschan-im-konflikt-16974972.html.
[207]
Russ Buettner, Susanne Craig und Mike McIntire. »Long-Concealed Records Show Trump’s Chronic Losses And Years Of Tax Avoidance.« The New York Times, Sept. 27, 2020, https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html.
[208]
Renzo Ruf. »Trump und Biden liefern sich beim ersten Fernsehduell vor der Präsidentschaftswahl ein erbittertes Gefecht.« Neue Zürcher Zeitung, 30.09.2020, https://www.nzz.ch/international/erstes-tv-duell-von-biden-und-trump-kampf-der-gladiatoren-ld.1579225.
[209]
James Barron. »Verne Edquist, Virtuoso Piano Tuner, Is Dead at 89.« The New York Times, Oct. 1, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/01/arts/music/verne-edquist-dead.html.
[210]
Daniel Mendelsohn. »The Rings of Sebald.« The Paris Review, October 1, 2020, https://www.theparisreview.org/blog/2020/10/01/the-rings-of-sebald/.
[211]
Peter Baker und Maggie Haberman. »Trump Tests Positive for the Coronavirus.« The New York Times, Oct. 2, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/02/us/politics/trump-covid.html.
[212]
Jed Perl. »The Cults of Wagner.« Rezension zu Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music, von Alex Ross. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 15, October 8, 2020, pp. 17-9.
[213]
James Gleick. »Simulating Democracy.« Rezension zu If Then: How the Simulmatics Corporation Invented the Future, von Jill Lepore. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 15, October 8, 2020, pp. 20-2.
[214]
Dalya Alberge. »How a TV baseball movie inspired late Lennon love song.« The Guardian, 4 Oct 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/oct/04/how-a-tv-baseball-movie-inspired-late-lennon-love-song.
[215]
Michael S. Roth. »Polymaths want to know everything — but ›everything‹ isn’t what it used to be.« Rezension zu The Polymath. A Cultural History From Leonardo da Vinci to Susan Sontag, von Peter Burke. The Washington Post, Oct. 2, 2020, https://www.washingtonpost.com/outlook/polymaths-want-to-know-everything–but-everything-isnt-what-it-used-to-be/2020/10/01/407e7236-cb8b-11ea-91f1-28aca4d833a0_story.html.
[216]
Frank Lübberding. »›Wir brauchen keine Weißen, die uns erzählen, wer uns kränkt.‹« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-hart-aber-fair-wir-brauchen-keine-weissen-die-uns-erzaehlen-wer-uns-kraenkt-16988104.html.
[217]
Ryan Christoffel. »Ulysses 21 Brings Revision Mode to iPhone and iPad Alongside Updated Design.« MacStories, Oct 6, 2020, https://www.macstories.net/reviews/ulysses-21-brings-revision-mode-to-iphone-and-ipad-alongside-updated-design/.
[218]
Julian Baggini. »Think Jacques Derrida was a charlatan? Look again.« Rezension zu An Event, Perhaps: A Biography of Jacques Derrida, von Peter Salmon. Prospect, October 4, 2020, https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/jacques-derrida-philosopher-not-overrated.
[219]
Robert D. McFadden. »Lyon Gardiner Tyler Jr., Grandson of the 10th President, Dies at 95.« The New York Times, Oct. 7, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/07/us/lyon-gardiner-tyler-jr-dead.html.
[220]
Thomas Thiel. »Zeit der Schlagwörter.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/folgen-der-online-lehre-zeit-der-schlagwoerter-16987869.html.
[221]
Alex Marshall und Alexandra Alter. »Louise Glück Is Awarded Nobel Prize in Literature.« The New York Times, Oct. 8, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/08/books/nobel-prize-literature-winner.html.
[222]
Andreas Platthaus. »Beglückende Dichtung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/literaturnobelpreis-fuer-louise-glueck-beglueckende-dichtung-16992130.html.
[223]
»Mehr als 4500 Neuinfektionen in Deutschland.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zweite-corona-welle-mehr-als-4500-neuinfektionen-in-deutschland-16993352.html.
[224]
Karen Crouse. »The French Open Will Probably Finish. But This Tournament Has Not Been Normal.« The New York Times, Oct. 9, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/09/sports/tennis/french-open-coronavirus.html.
[225]
Alexandra Alter. »›I Was Unprepared‹: Louise Glück on Poetry, Aging and a Surprise Nobel Prize.« The New York Times, Oct. 8, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/08/books/louise-gluck-nobel-prize-literature.html.
[226]
Rüdiger Zill. Der absolute Leser. Hans Blumenberg – Eine intellektuelle Biographie. Suhrkamp, 2020.
[227]
Katrin Bennhold. »QAnon Is Thriving in Germany. The Extreme Right Is Delighted.« The New York Times, Oct. 11, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/11/world/europe/qanon-is-thriving-in-germany-the-extreme-right-is-delighted.html.
[228]
Tim Parks. »Whatever It Takes.« Rezension zu Machiavelli: The Art of Teaching People What to Fear, von Patrick Boucheron, sowie Machiavelli: His Life and Times, von Alexander Lee. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 16, October 22, 2020, pp. 41-3.
[229]
Keith Thomas. »›Subtle, False and Treacherous.‹« Rezension zu Richard III: The Self-Made King, von Michael Hicks. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 16, October 22, 2020, pp. 49-51.
[230]
»French-Open-Final: Rafael Nadal bezwingt Novak Djokovic und feiert in Roland-Garros seinen 13. Turniersieg.« Neue Zürcher Zeitung, 11.10.2020, [www.nzz.ch/sport/fre….
[231]
Thomas Fuster. »Forscher der Universität Zürich zeigen: Unmoralisches Arbeiten macht sich bezahlt.« Neue Zürcher Zeitung, 12.10.2020, https://www.nzz.ch/wirtschaft/studie-der-uni-zuerich-unmoralisches-arbeiten-macht-sich-bezahlt-ld.1579764.
[232]
»Fehler-Fetisch? Eine Lektorin über zwanghaftes Korrigieren.« Westfalenpost, https://www.wp.de/region/sauer-und-siegerland/fehler-fetisch-eine-lektorin-ueber-zwanghaftes-korrigieren-id230597638.html.
[233]
Fabian Thunemann. »Der Mensch ist ein Taugenichts. Wenn er das erkennt, kann er seinen Möglichkeiten entsprechend handeln – ein Blick auf das skeptisch-entspannte Denken von Odo Marquard.« Neue Zürcher Zeitung, 12.10.2020, [www.nzz.ch/feuilleto…
[234]
Marie Fazio. »An Italian Teenager Could Become the First Millennial Saint.« The New York Times, Oct. 12, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/12/world/europe/millennial-saint-carlo-acutis.html.
[235]
John Voorhees. »Apple’s HomePod mini: The MacStories Overview.« MacStories, Oct 14, 2020, https://www.macstories.net/news/apples-homepod-mini-the-macstories-overview/.
[236]
»RKI meldet Rekord bei Neuinfektionen: 6638 Fälle.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-meldet-rekord-bei-neuinfektionen-6638-faelle-17002589.html.
[237]
Ben Beaumont-Thomas. »Spencer Davis, bandleader with the Spencer Davis Group, dies aged 81.« The Guardian, 20 Oct 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/oct/20/spencer-davis-frontman-spencer-davis-group-dies-aged-81.
[238]
Nate Chinen. »Keith Jarrett Confronts a Future Without the Piano.« The New York Times, Oct. 21, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/21/arts/music/keith-jarrett-piano.html.
[239]
»Mehr als 11.000 bestätigte Neuinfektionen in Deutschland.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-mehr-als-bestaetigte-11-000-neuinfektionen-in-deutschland-17014050.html.
[240]
Douglas Brinkley. »Inside Bob Dylan’s Lost Interviews and Unseen Letters.« Rolling Stone, October 21, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-features/bob-dylan-lost-letters-interviews-tony-glover-1074916/.
[241]
Anna Leszkiewicz. »Hermione Lee on how to write a life.« New Statesman 21 October 2020, https://www.newstatesman.com/culture/books/2020/10/hermione-lee-how-write-life.
[242]
Joachim Müller-Jung. »Neues Organ im Rachen entdeckt.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/niederlaendische-forscher-entdecken-neues-organ-im-rachen-17015119.html.
[243]
Peter Eisenberg. »Warum korrekte Grammatik keine Gendersternchen braucht.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/richtige-grammatik-braucht-keine-sonderzeichen-fuers-geschlecht-17015164.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.
[244]
»Mehr als 10.000 Corona-Tote in Deutschland seit Pandemie-Beginn.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/robert-koch-institut-mehr-als-10-000-corona-tote-in-deutschland-seit-pandemie-beginn-17017625.html.
[245]
Simon M. Ingold. »Der Individualismus ist zu einer Karikatur seiner selbst geworden.« Neue Zürcher Zeitung, 26.10.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/individualismus-ein-grosses-prinzip-ist-ausser-kontrolle-geraten-ld.1583303.
[246]
Tilmann Warnecke. »Plagiatsverfahren gegen Giffey laut Gutachten mehrfach rechtswidrig.« Der Tagesspiegel, 28.10.2020, https://www.tagesspiegel.de/wissen/doktortitel-haette-entzogen-werden-muessen-plagiatsverfahren-gegen-giffey-laut-gutachten-mehrfach-rechtswidrig/26564698.html.
[247]
»RKI meldet 19.059 Neuinfektionen binnen eines Tages.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/rki-meldet-19-059-corona-neuinfektionen-in-deutschland-17029254.html.
[248]
Aljean Harmetz. »Sean Connery, Who Embodied James Bond and More, Dies at 90.« The New York Times, Oct. 31, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/31/movies/sean-connery-dead.html.
[249]
Melanie Möller. »Von der Freiheit des Denkens und der Intensität des Lebens: Baltasar Gracián ist neu zu entdecken.« Rezension zu Handorakel und Kunst der Weltklugheit, von Balthasar Gracián in der Übersetzung Hans Ulrich Gumbrechts. Neue Zürcher Zeitung, 02.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/baltasar-gracians-handorakel-von-der-freiheit-des-denkens-ld.1584370.
[250]
Ingeborg Villinger. Gretha Jünger. Die unsichtbare Frau. Klett-Cotta, 2020.
[251]
Paul Noack. Ernst Jünger. Eine Biographie. Alexander Fest, 1998.
[252]
Jonathan Martin und Alexander Burns. »Biden Wins Presidency, Ending Four Tumultuous Years Under Trump.« The New York Times, Nov. 7, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/07/us/politics/biden-election.html.
[253]
Nico Hoppe. »Ich fühle mich diskriminiert, zum Glück!: Wie die identitäre Linke den Universalismus entsorgt.« Rezension zu Generation Beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer, von Caroline Fourest. Neue Zürcher Zeitung, 09.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/generation-beleidigt-wie-die-linke-den-universalismus-entsorgt-ld.1585016.
[254]
Ulrich Rüdenauer. »Im Zauberrausch des Anfangs.« Rezension zu Archives Vol. 1, von Joni Mitchell. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. November 2020, p. 9.
[255]
Jørgen Sneis und Carlos Spoerhase. »Geldsegen aus Stockholm.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. November 2020, p. 13.
[256]
Markus Schär. »Depressionen, Drogen, Corona: Nachdem Jordan Peterson durch mehrere Höllen gegangen ist, ist er zurück.« Neue Zürcher Zeitung, 10.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/jordan-peterson-durch-die-hoelle-und-zurueck-ld.1586212.
[257]
Thomas Thiel. »Toleranz im geschlossenen Zirkel.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/toleranz-studie-ueber-meinungsfreiheit-an-hochschulen-17044294.html.
[258]
Jack Nicas und Don Clark. »Apple Introduces New Macs With the First Apple Chips.« The New York Times, Nov. 10, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/10/technology/apple-chips-intel.html.
[259]
Alexander Demling. »Apple rüstet seine Macs für das Home-Office-Zeitalter.« Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2020, [www.nzz.ch/technolog….
[260]
Uwe Wolff. »›Die Offenbarung der Sophia‹.« Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 12. November 2020, p. 18.
[261]
Jochen Zenthöfer. »Familienministerin Giffey verzichtet auf Doktorgrad.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/plagiatsfall-familienministerin-giffey-verzichtet-auf-doktorgrad-17051134.html.
[262]
Jan Bürger. »Emanzipation als Nothilfe. Die Befreiung der Frau und der verlorene Krieg.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 13-24.
[263]
Sabina Becker. »Verhaltenslehren der Emanzipation. ›Neue Frauen‹ in Weimar.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 30-7.
[264]
Katharine Q. Seelye. »Joanna Harcourt-Smith, Lover of Timothy Leary, High Priest of LSD, Dies at 74.« The New York Times, Nov. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/14/us/joanna-harcourt-smith-dead.html.
[265]
Heike Schmoll. »Ein Doktorgrad ist kein Schmuckstück.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/giffeys-dissertation-ein-doktorgrad-ist-kein-schmuckstueck-17053728.html.
[266]
Meike G. Werner. »Frau mit Ehe. Elisabeth Czapski, verheiratete Flitner.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 38-43.
[267]
Thomas Wagner. »Helmut Lethen: Ein Leben von den Bombennächten bis zur Flüchtlingskrise.« Rezension zu Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Erinnerungen, von Helmut Lethen. Neue Zürcher Zeitung, 16.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/helmuth-lethen-legt-erinnerungen-aus-seinem-leben-vor-ld.1584556.
[268]
Christoph Schmälzle. »Der Mann ist ja völlig kahl.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/weimarer-klassikpflege-goethe-und-schillers-kahle-ueberreste-17055984.html.
[269]
Andreas Mayer. »Wie schreibt man keine Freud-Biographie?« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 68-84.
[270]
Paul Jandl. »Vielleicht war Paul Celan einmal ganz er selbst. Da spielte er die Dürrenmatts beim Tischtennis in Grund und Boden.« Neue Zürcher Zeitung, 23.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/paul-celan-wurde-vor-100-jahren-in-czernowitz-geboren-ld.1588120.
[271]
Julia Anton. »Die Tiktok-Queen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/charlie-d-amelio-hat-als-erste-100-millionen-fans-auf-tiktok-17068768.html.
[272]
Jürgen Kaube. »Nichts, was wir erinnern können, ist vorbei.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-von-klaus-heinrich-17069031.html.
[273]
Stefan Diebitz. »Nicolai Hartmann: Dialoge 1920-1950. Die ›Cirkelprotokolle‹.« KulturPort.De, 24. November 2020, https://www.kultur-port.de/kolumne/buch/16804-nicolai-hartmann-dialoge-1920-1950-die-cirkelprotokolle.html.
[274]
Jeré Longman. »Diego Maradona, One of Soccer’s Greatest Players, Is Dead at 60.« The New York Times, Nov 25, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/25/sports/soccer/diego-maradona-dead.html.
[275]
Andreas Platthaus. »Thomas Manns Deutschlandbild auf dem Prüfstand.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/mutuallymann-thomas-manns-deutschlandbild-auf-dem-pruefstand-17066535.html.
[276]
Uwe Wolff. »Das gnostische Trauma.« Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 26. November 2020, p. 18.
[277]
David Browne. »George Harrison Estate Releases New Mix of ›All Things Must Pass‹ Title Track.« Rolling Stone, November 27, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/george-harrison-all-things-must-pass-song-50th-anniversary-mix-1092728/.
[278]
Mike Jay. »›The Hide That Binds.« Rezension zu Dark Archives: A Librarian’s Investigation into the Science and History of Books Bound in Human Skin, von Megan Rosenbloom. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 17, November 5, 2020, pp. 49-51.
[279]
Andy Greenberg. »Hacker Lexicon: What Is the Signal Encryption Protocol?« Wired, 11.29.2020, https://www.wired.com/story/signal-encryption-protocol-hacker-lexicon/.
[280]
Sandra Kostner. »Wer den strukturellen Rassismus leugnet, muss selbst ein Rassist sein – Analyse eines äusserst gefährlichen Denkfehlers.« Neue Zürcher Zeitung, 01.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/struktureller-rassismus-analyse-eines-gefaehrlichen-denkfehlers-ld.1589216.
[281]
Ernst Ziegler. Drei Miniaturen zu Schopenhauer und Platon, Aristoteles, Plotin, sowie eine Explicatio, Ernst Ziegler und Arthur Schopenhauer. Books on Demand, 2020.
[282]
[Alexandra Alter und Elizabeth A. Harris. »Readers Have Been Eagerly Waiting for Barack Obama’s New Memoir. Struggling Booksellers Have, Too.« The New York Times, Nov. 16, 2020, www.nytimes.com/2020/11/1…](https://denkkerker.com/2020/12/01/der-promischtland/)
[283]
Andy Greene. »Bob Dylan Just Released the Ultra-Rare 1970 ›George Harrison Sessions‹ Without Warning.« Rolling Stone, December 1, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/bob-dylan-george-harrison-sessions-1097129/.
[284]
Paul Ingendaay. »Der Ironman der Literaturpreise.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/mario-vargas-llosa-ist-der-ironman-der-literaturpreise-17074207.html.
[285]
Christoph Schmälzle. »Goethes Aufklärer.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/der-goethe-kritiker-w-daniel-wilson-wird-70-17081924.html.
[286]
Anastasia Berg. »We Deserve Better From Our Public Intellectuals. On Kate Manne’s new book, incels, and the perils of public philosophy.« The Chronicle of Higher Education, December 2, 2020, https://www.chronicle.com/article/the-perils-and-promises-of-public-philosophy.
[287]
Margot Sanger-Katz, Claire Cain Miller und Quoctrung Bui. »How 700 Epidemiologists Are Living Now, and What They Think Is Next.« The New York Times, Dec. 4, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/04/upshot/epidemiologists-virus-survey-.html.
[288]
Holger Kleine. »Viel Charlie Chaplin steckt in ihm.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/beethovens-umgang-mit-kleinen-formen-17079912.html.
[289]
Ligaya Mishan. »The Long and Tortured History of Cancel Culture.« The New York Times, Dec. 3, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/03/t-magazine/cancel-culture-history.html.
[290]
Katharina Teutsch. »Als diese Frauen sich das Schreiben eroberten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/als-frauen-wie-milena-jesenska-das-schreiben-eroberten-17085304.html.
[291]
Markus Schär. »Der Anthropologe Carel van Schaik sagt: ›Wie viele Leute glauben denn wirklich, dass das Geschlecht überhaupt nichts mit der Biologie zu tun habe?‹« Neue Zürcher Zeitung, 07.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/anthropologe-van-schaik-klar-hat-geschlecht-mit-biologie-zu-tun-ld.1589818.
[292]
Ben Sisario. »Bob Dylan Sells His Songwriting Catalog in Blockbuster Deal.« The New York Times, Dec. 7, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/07/arts/music/bob-dylan-universal-music.html.
[293]
[Scott Spencer. »›We Are Better People Because of John Lennon.‹« Rolling Stone, December 8, 2020, www.rollingstone.com/feature/j…](https://denkkerker.com/2020/12/09/time-games/)
[294]
Barbara Graustark. »For John Lennon, Isolation Had a Silver Lining.« The New York Times, Dec. 8, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/08/arts/music/john-lennon-isolation.html.
[295]
»Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen, Marke von 20.000 Toten überschritten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/rki-hoechstwert-an-corona-neuinfektionen-und-20-000-todesfaelle-17094788.html.
[296]
Alexis Petridis. »Paul McCartney: McCartney III review – lockdown LP has his best songs in years.« The Guardian, 10 Dec 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/dec/10/paul-mccartney-mccartney-iii-review.
[297]
Thomas Thiel. »Schmuckstück der Aufklärung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/was-das-goettinger-lichtenberg-kolleg-so-besonders-macht-17095665.html.
[298]
»Was die Bundesländer für Weihnachten planen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lockdown-so-planen-die-bundeslaender-fuer-die-kommenden-wochen-17098320.html
[299]
Michael Levenson. »51 Years Later, Coded Message Attributed to Zodiac Killer Has Been Solved, F.B.I. Says.« The New York Times, Dec. 11, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/11/us/zodiac-killer-code-broken.html.
[300]
Wolfgang Matz. »Ein Philosoph spielt Roulette.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/howard-eilands-und-michael-w-jennings-benjamin-biographie-17049091.html.
[301]
Michael Stallknecht. »250 Jahre Beethoven: Was vom Meister bleibt.« Neue Zürcher Zeitung, 13.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/250-jahre-beethoven-was-vom-meister-bleibt-ld.1591402.
[302]
Jordan Runtagh. »Beatles’ Rare Fan-Club Christmas Records: A Complete Guide.« Rolling Stone, December 13, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-lists/beatles-rare-fan-club-christmas-records-a-complete-guide-120854/another-beatles-christmas-record-1964-121096/.
[303]
Dieter Thomä. »Die Sexualität der großen Denker.« Rezension zu »Die Liebe der Philosophen.« Von Sokrates bis Foucault, von Manfred Geier. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/manfred-geiers-werk-ueber-die-sexualitaet-der-grossen-philosophen-17067101.html.
[304]
Jochen Zenthöfer. »›VroniPlag Wiki‹ kritisiert FU-Bericht zu Giffey.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/plagiat-wissenschaftsplattform-kritisiert-fu-bericht-zu-giffey-17103066.html.
[305]
Anthony Tommasini. »Beethoven’s 250th Birthday: His Greatness Is in the Details.« The New York Times, Dec. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/14/arts/music/beethoven-250-birthday-classical.html.
[306]
»Mehr junge Menschen sind mediensüchtig.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/mehr-junge-menschen-sind-mediensuechtig-17103055.html.
[307]
»Mehr als 27.000 Neuinfektionen, fast 1000 Tote in 24 Stunden.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-mehr-als-27-000-neuinfektionen-und-fast-1000-tote-17104557.html.
[308]
Jeremy Samuel Faust, Harlan M. Krumholz und Rochelle P. Walensky. »People Thought Covid-19 Was Relatively Harmless for Younger Adults. They Were Wrong.« The New York Times, Dec. 16, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/16/opinion/covid-deaths-young-adults.html.
[309]
Jon Blistein. »Ringo Starr Taps Paul McCartney, Dave Grohl, More for New Song ›Here’s to the Nights‹.« Rolling Stone, December 16, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/ringo-starr-new-song-heres-to-the-nights-zoom-in-ep-1104645/.
[310]
Gabriele Diewald und Damaris Nübling. »Genus und Sexus: Es ist kompliziert.« Neue Zürcher Zeitung, 17.12.2020, [www.nzz.ch/feuilleto….
[311]
Johanna Kuroczik. »›Meine Ohren, die sausen und brausen.‹« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/beethoven-als-patient-der-grosse-komponist-ein-schwerkranker-mann-17096122.html.
[312]
»RKI verzeichnet erstmals mehr als 30.000 Corona-Neuinfektionen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-meldet-erstmals-mehr-als-30-000-corona-neuinfektionen-17108366.html.
[313]
Jörg Später. »Auftritte der Meinungsbildner.« Rezension zu Medien-Intellektuelle in der Bundesrepublik, von Axel Schildt. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/axel-schildts-buch-medien-intellektuelle-in-der-bundesrepublik-17060665.html.
[314]
Julie Besonen. »Will a Famous Critic’s Desk Cure My Writer’s Block?« The New York Times, Dec. 17, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/17/nyregion/vincent-canby-nyc.html.
[315]
Alexandra Alter. »Their Publishing Imprint Closed. Now They’re Bringing It Back.« The New York Times, Dec. 18, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/18/books/spiegel-grau-publishing.html.
[316]
Andrew Katzenstein. »A Well-Ventilated Conscience.« Rezension zu Posthumous Memoirs of Brás Cubas, von Joaquim Maria Machado de Assis, übersetzt von Margaret Jull Costa und Robin Patterson, sowie The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, von Machado de Assis, übersetzt von Flora Thomson-DeVeaux. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 20, Dezember 17, 2020, pp. 46-8.
[317]
Atossa Araxia Abrahamian. »The Right to Belong.« Rezension zu Statelessness: A Modern History von Mira L. Siegelberg, sowie Citizenship, von Dimitry Kochenov. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 20, Dezember 17, 2020, pp. 49-51.
[318]
Maggie Haberman und Michael S. Schmidt. »Trump Gives Clemency to More Allies, Including Manafort, Stone and Charles Kushner.« The New York Times, Dec. 23, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/23/us/politics/trump-pardon-manafort-stone.html.
[319]
Ueli Bernays. »Paul McCartney: Songs schreiben am Tag, gut essen am Abend.« Neue Zürcher Zeitung, 24.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/paul-mccartney-ein-album-aus-dem-rockdown-ld.1593455.
[320]
»101 Jahre alte Frau hat erste Corona-Impfung in Deutschland erhalten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/101-jahre-alte-frau-hat-erste-corona-impfung-in-deutschland-erhalten-17119079.html.
[321]
Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018.
[322]
Brenda Wineapple. »›A Land Where the Dead Past Walks‹.« Rezension zu The Life of William Faulkner: The Past Is Never Dead, 1897-1934, von Carl Rollyson, The Life of William Faulkner: This Alarming Paradox, 1935-1962, von Carl Rollyson, sowie The Saddest Words: William Faulkner’s Civil War, von Michael Gorra. The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 1, January 14, 2021, pp. 4-8.
[323]
Gabriela Lena Frank. »I Think Beethoven Encoded His Deafness in His Music.« The New York Times, Dec. 27, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/27/arts/music/beethoven-hearing-loss-deafness.html.
[324]
Margalit Fox. »Reginald Foster, Vatican Latinist Who Tweeted in the Language, Dies at 81.« The New York Times, Dec. 27, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/27/obituaries/reginald-foster-vatican-latinist-who-tweeted-in-the-language-dies-at-81.html.
[325]
Urs Hafner. »Suhrkamp schreibt das Denken klein: Wie ein einziger Buchstabe das Vertrauen in eine Institution erschüttern kann.« Neue Zürcher Zeitung, 28.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/suhrkamp-schreibt-das-denken-klein-wie-ein-buchstabe-das-vertrauen-in-eine-institution-erschuettern-kann-ld.1590690
[326]
[Alfred Brendel. »Goethe, Musik und Ironie.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.12.2020, www.faz.net/aktuell/f…](https://denkkerker.com/2020/12/29/corona-prae-eventum/)
[327]
Marion Löhndorf. »Sie wird gehasst, bedroht und gelesen - jetzt kann sich Julie Burchill als Opfer der Cancel-Culture inszenieren.« Neue Zürcher Zeitung, 29.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/julie-burchill-als-opfer-der-cancel-culture-ld.1593427.
[328]
Jean-Paul Sartre. Die Wörter. Übersetzt und mit einer Nachbemerkung von Hans Mayer. 35. Aufl., Rowohlt, 2005. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. In Zusammenarbeit mit dem Autor und Arlette Elkaïm-Sartre begründet von Traugott König, herausgegeben von Vincent von Wroblewsky. Autobiographische Schriften, Bd. 1.
[329]
Parul Sehgal. »Nearly a Century Later, We’re Still Reading — and Changing Our Minds About — Gatsby.« The New York Times, Dec. 30, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/30/books/great-gatsby-fitzgerald-copyright.html.
Corona prae eventum
Ich stoße in Alfred Brendels FAZ-Gastbeitrag über Goethe und die Musik auf den Namen der Sopranistin Corona Schröter (1751-1802), die neben anderen Sängerinnen auf Goethe eine ›unübertreffliche Wirkung‹ ausgeübt haben soll. Daß ihr Name dem heutigen Leser ins Auge springt, liegt in der simplen Tatsache begründet, daß eine Pandemie gleichen Namens ungleich größere Auswirkungen verursacht hat.
»So häuft sie willig jeden Reiz auf sich,
Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.«
Alfred Brendel. »Goethe, Musik und Ironie.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/goethe-musik-und-ironie-ein-gastbeitrag-von-alfred-brendel-17076178.html.
Johann Wolfgang Goethe. »Auf Miedings Tod.« Erstes Weimarer Jahrzehnt 1775-1786. I. Herausgegeben von Hartmut Reinhardt. Hanser, 1987. Genehmigte Taschenbuchausgabe. btb, 2006, pp. 66-72, hier p. 71 [V 171-2]. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 2.1.
Sloterdijks Berufe
- Opiniater / Facharzt für Erkrankungen des Meinungsapparats
- Fachmann für nicht-periodische Kachelsysteme
- Skorpionmelker
- Anomalist
- Brainfood-Berater
- Licht-Konservator
- Komponist für Veterinärmusik
- Empathieplünderer
- Oligarchenseelsorger
- Schrumpfungskommissionsberater
- Kryptozoologe: Experte für nie festgestellte Tiere
- Lawn doctor an Bord eines Kreuzfahrtschiffs
- Implantationssoziologe
- Gratis-Dienste-Berater (hilft Ihnen, alles zu bekommen, ohne je in die eigene Tasche zu greifen)
- Erdbeweger (steirisch)
- Paläo-Ozeanograph / Jeder Beruf ist ein nicht geschriebener Roman in der comédie humaine unserer Tage. Man muß mehr denn je Romane nicht schreiben
- Gasfeuerzeug-Adapter-Designer (es gibt ca. 3000 Modelle von Gasfeuerzeugen in der Welt, davon die meisten mit Hilfe von speziellen Aufsteckröhrchen nachfüllbar)
- Luxurologe
- Sizilianist
- Kolaphologe / Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen
- Ungeschehenmacher
- Resilienz-Berater
- Traum-Restaurator
- Internist, nicht-medizinisch
- Menetekel-Kalligraph
- Hersteller von Zielfernrohren für Flinten zur Subventionen-Jagd
- reputation defender
- Inkarnationsberater
- Nahegeher
- Erwartungenübertreffer
Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, pp. 22, 64, 121, 166, 168, 169, 333, 368, 383, 393, 428, 433, 445, 446, 454, 455, 456, 462, 520, 549, 553.
Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, pp. 17, 255, 261, 324, 361, 376, 386, 423, 427.
Time Games
Das Rolling Stone Magazine wiederveröffentlicht anläßlich John Lennons vierzigstem Todestag einen Nachruf aus seiner Ausgabe vom 22. Januar 1981, geschrieben vom damals fünfunddreißigjährigen Journalisten und Schriftsteller Scott Spencer. Darin findet sich – neben vielen Plattitüden – der elementar philosophische Gedanke des Sterbenlernens, der in Zeiten einer Pandemie ins Bewußtsein der Menschen zurückzukehren im Begriff ist: »Weil er uns erlaubte, ihn zu kennen und zu lieben, gab John Lennon uns die Chance, an seinem Tod teilzuhaben und die Vorbereitungen für unseren eigenen wiederaufzunehmen.«
Der Zeitpunkt seines Todes ist gesichert überliefert: Es war der 8. Dezember 1980. »At 11:15 P.M.«, heißt es in Keith Elliot Greenbergs faszinierender Analyse December 8, 1980. The Day John Lennon Died, »John Lennon was officially pronounced dead.« Beachtet man den Zeitunterschied zwischen Liverpool, wo Lennon geboren, und New York City, wo er ermordet wurde, so trat der Tod des Musikers in seiner Heimatzeitzone morgens um 4:15 Uhr am 9. Dezember 1980 ein. Aus diesem temporalen Grund erinnere ich erst am heutigen 9. Dezember an den Tod des einflußreichen Imaginaristen. — So keep on playing those time games together / Faith in the future out of the now —
Scott Spencer. »›We Are Better People Because of John Lennon.‹« Rolling Stone, December 8, 2020, www.rollingstone.com/feature/j…
Keith Elliot Greenberg. December 8, 1980. The Day John Lennon Died. Backbeat Books, 2010, p. 172.
Das Ende der Schönheit
Finde in Sloterdijks Notizen unter dem Datum des 29. September 2011 die triviale, aber erstaunliche Feststellung: »Casanova soll gesagt haben, auch die schönste Frau ist an den Füßen zu Ende.« Diese Äußerung ist in ihrer Resignation zugleich tröstlich als auch lächerlich. Tröstlich, weil einem die engen Grenzen der physischen Attraktivität leger vor Augen geführt werden; lächerlich, weil Casanova die weiten Dimensionen der psychischen Schönheit nicht wahrnehmen konnte oder wollte; die Kartographierung der terra incognita fand nicht statt.
Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, p. 160.
Der Promischtland
Die New York Times berichtet, daß die Nachfrage der amerikanischen Leser nach Barack Obamas erstem Teil seiner Memoiren, A Promised Land, so hoch sei, daß Penguin Random House, die Muttergesellschaft von Crown, in Deutschland 1,5 Millionen Exemplare gedruckt habe, die auf Frachtschiffen in die USA transportiert würden. Dies brachte Stephen Colbert zu folgender Einschätzung: »Aber ich bin mir sicher, die Kunden werden den Unterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen Version nicht bemerken.«
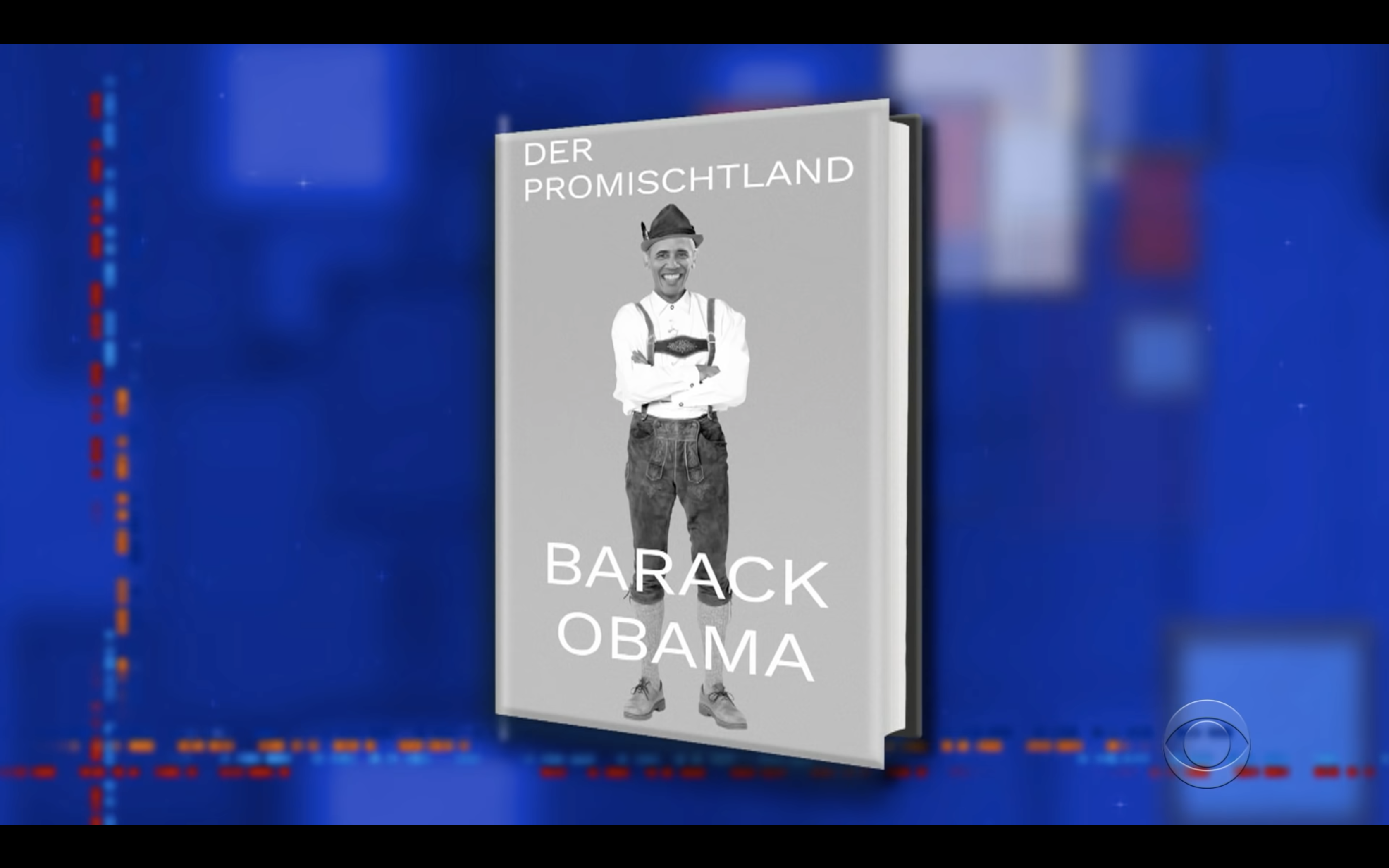 The Late Show with Stephen Colbert: »Der Promischtland«
The Late Show with Stephen Colbert: »Der Promischtland«
Alexandra Alter und Elizabeth A. Harris. »Readers Have Been Eagerly Waiting for Barack Obama’s New Memoir. Struggling Booksellers Have, Too.« The New York Times, Nov. 16, 2020, www.nytimes.com/2020/11/1…
»Stephen Kicks Off A Late Show’s Obama-Rama Extravagama With A Special Obamalogue.« The Late Show with Stephen Colbert, 01.12.2020, 2:03-2:10, www.youtube.com/watch
Die Beständige
Ingeborg Villinger beleuchtet erstmals das Leben von »Gretha Jünger«
Im 14. Kapitel seiner 1939 erschienenen Parabel Auf den Marmorklippen beschreibt Ernst Jünger (1895–1998): »Es hieß, daß Pater Lampros einem altburgundischen Geschlecht entstamme, doch sprach er niemals über die Vergangenheit. Aus seiner Weltzeit hatte er einen Siegelring zurückbehalten, in dessen roten Karneol ein Greifenflügel eingegraben war, darunter die Worte ›meyn geduld hat ursach‹ als Wappenspruch. Auch darin verrieten sich die beiden Pole seines Wesens – Bescheidenheit und Stolz.« [Weiterlesen auf literaturkritik.de]
 Rezensionsexemplar: Ingeborg Villingers Gretha-Jünger-Biographie
Rezensionsexemplar: Ingeborg Villingers Gretha-Jünger-Biographie
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2020)
Das Glück des Cristiano Ronaldo
Der in Harvard lehrende Moralphilosoph Michael Sandel erinnert in einem Interview anläßlich der Publikation seines neuen Buches Vom Ende des Gemeinwohls an etwas Triviales, dessen man sich in unserer heutigen Leistungs- und Wertegesellschaft jedoch unbedingt bewußt sein sollte (ich zitiere den Dolmetscher):
Nehmen wir etwa einen sehr erfolgreichen Sportler wie Cristiano Ronaldo, der Dutzende Millionen an Gehalt einstreicht, ein bedeutender Fußballspieler. Aber ist das wirklich sein eigenes Verdienst, die Talente, die er hat, daß er so gut Fußball spielt? Hat er nicht auch großes Glück gehabt? Ist es nicht auch Zufall, daß er in einer Gesellschaft lebt, die eben Fußballspielen so schätzt und die ihm es ermöglicht hat, solchen Erfolg zu erringen? Hätte er in der Renaissance gelebt, wo die Menschen eben für Fußball nicht so große Achtung hegten, sondern vielleicht eher für Fresko-Maler, da hätte sein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. Und so gilt es eben auch für die Wirtschaft insgesamt: Wir, die wir Erfolg haben im Wirtschaftsleben, sollten uns immer dessen bewußt sein, daß wir Glück haben, daß wir eben belohnt werden für das, was wir können, durch eine Gesellschaft, die eben zufälligerweise das schätzt, worin wir gut sind.
Die heute Erfolgreichen sollten also Demut zeigen und Angst haben vor einer neuen Renaissance – aber vielleicht ist diese bereits subtil am Werk.
»Philosoph Michael Sandel über Corona in den USA (Gespräch).« Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit, 1. November 2020, 21:16-22:20, podcast-mp3.dradio.de/podcast/2…
Uplifting!
Am heutigen 30. Oktober erscheint das inzwischen 31. Studioalbum des sechsundsechzigjährigen britischen Musikers Declan Patrick MacManus, besser bekannt als Elvis Costello. Es trägt den Titel Hey Clockface, und in dessen Titelsong »Hey Clockface / How Can You Face Me?« unternimmt Costello inhaltlich wie musikalisch eine Zeitreise:
Hey Clockface
Now I don’t feel a thing
You stole away the heart in me
And then removed my spring
The winding mechanisms shot
The movement is unwound
Don’t tick or tock or dare to make a sound
Für Stephen Colberts Late Show führte Costello diesen Song kongenial mit Jon Batiste auf, dem Bandleader und musikalischen Leiter der Late Show. Der talentierte Batiste, Jahrgang 1986, dessen rachmaninowgleiche Hände federleicht über die Klaviatur schweben, ist mit dem seltenen Talent gesegnet, allein schon durch Mimik und Körpersprache Musik zu vermitteln und erlebbar zu machen. Zusammen mit Costellos markanter Stimme kann diese Unplugged-Version nur mit dem schönen englischen Prädikat »uplifting« belegt werden, das im Deutschen ein wenig antiquiert als »erbaulich« oder »erhebend« daherkommt — aber was könnte Musik mehr bewirken, erst recht in Zeiten einer Pandemie?
Elvis Costello “Hey Clockface / How Can You Face Me” feat. Jon Batiste
Unter Druck
Zwei Tage nach dem 39. Jahrestag der Veröffentlichung des Queen-/David-Bowie-Klassikers »Under Pressure« reihen sich Karen O und Willie Nelson in die illustre Cover-Riege dieses Klassikers ein. Ihre ruhige, zurücknehmende und doch kraftvoll-intime Interpretation wirkt wie ein willkommenes Antidot in rauschhaft-rauhen Zeiten, in denen der Druck immer größer zu werden und von immer mehr Seiten zu kommen scheint.
Digitales Suchen
Von Johanna Gummlich, Leiterin des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln, lerne ich ein neues Wort. Im Podcast »Deutsche Digitale Bibliothek stößt an Grenzen« des Deutschlandfunks erklärt sie: »Ich öffne die Deutsche Digitale Bibliothek und suche mir über den Suchschlitz die Digitalisate, die von unserem Haus, von dem Rheinischen Bildarchiv, in der Deutschen Digitalen Bibliothek vorhanden sind.«
 Bildschirmphoto des ›Suchschlitzes‹ der Deutschen Digitalen Bibliothek
Bildschirmphoto des ›Suchschlitzes‹ der Deutschen Digitalen Bibliothek
Daß die Suchleiste oder das Suchfeld einer Website als »Suchschlitz« bezeichnet wird, war mir neu. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr leuchtet mir diese Benennung ein: Der Schlitz beinhaltet ein Bersten, Spalten, Brechen, (Auf-)Reißen – und genau dies passiert, wenn man einen Suchbegriff in die Suchmaske, in den Suchschlitz eingibt: das Dunkle, Unsichtbare, Oberflächliche wird aufgebrochen, aufgerissen, ›aufgeschlitzt‹, um das Gesuchte, die Antwort, das Wissen freizulegen. Der (Such-)Schlitz konnotiert also etwas Aktives, Aggressives, Aufwendiges – sprich: eine (Such-)Bewegung, einen (Such-)Prozeß – und wäre somit dem eher passiven, diffusen (Such-)Feld oder der statischen (Such-)Leiste durchaus vorzuziehen.
Mirko Smiljanic. »Deutsche Digitale Bibliothek stößt an Grenzen.« Deutschlandfunk. Aus Kultur- und Sozialwissenschaften, 22. Oktober 2020, 1:54-2:11, podcasts.apple.com/de/podcas…
Der absolute Lektor
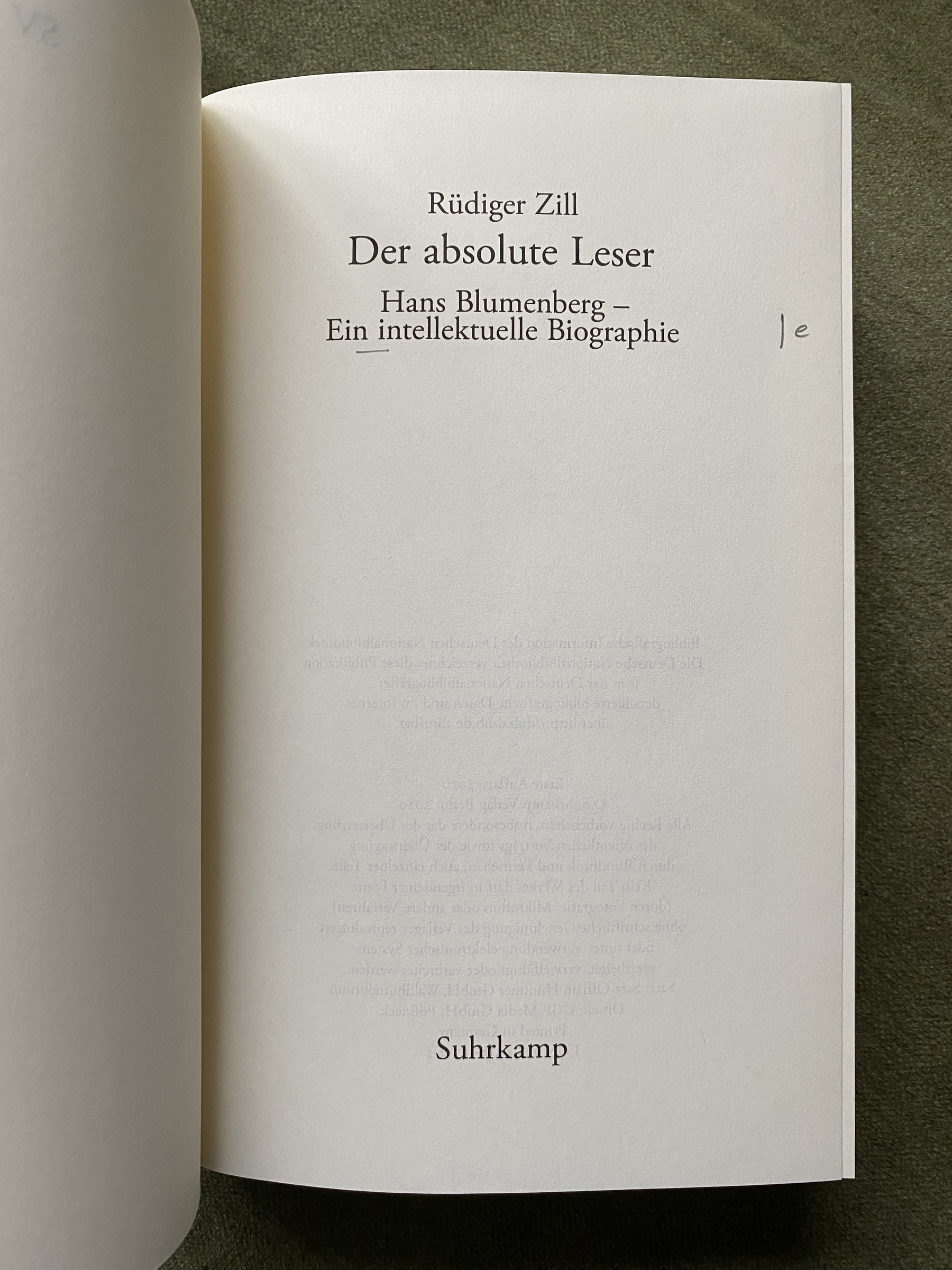 Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020
Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020
Der »Exorzist des Druckfehlerteufels« (Hans Blumenberg, 26. Februar 1996) stand für das Titelblatt nicht (mehr) zur Verfügung.
Hans Blumenberg und Uwe Wolff. »›Und das ist mir von der Liebe zur Kirche geblieben.‹ Hans Blumenbergs letzter Brief. Mit einem Nachwort von Uwe Wolf.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 173-81, hier p. 177.
Isolierter Doppelgeburtstag
Es erscheint nur folgerichtig und symbolisch, daß Sean Lennon, der am heutigen 9. Oktober 45 Jahre alt wird, seinem Vater John, dessen 80. Geburtstag ebenfalls heute zu feiern wäre, nicht nur an selbigen, sondern auch an die ›inselartigen‹ Lebenssituationen der Menschen in der COVID-19-Pandemie erinnert, und zwar mit dem 1970 auf dem Album John Lennon/Plastic Ono Band veröffentlichten Song »Isolation«. Daß der Sohn dabei nicht nur so aussieht wie der Vater, sondern auch so klingt, ist ein berückender Nebeneffekt.
Schadenfreude
Das vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika beliebte Wörterbuch Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary verzeichnet für den 2. Oktober einen Anstieg der Zugriffe auf das Lemma »schadenfreude« um 30.500 Prozent! Den Grund dafür sieht das Wörterbuch im positiven COVID-19-Test von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania.
»Trending: ›schadenfreude‹.« Merriam-Webster, October 2, 2020, www.merriam-webster.com/news-tren…
It was forty semesters ago today
Am heutigen 1. Oktober jährt sich der Beginn meines Hochschulstudiums zum zwanzigsten Mal: Zum Wintersemester 2000/2001 – Gerhard Schröder war seit zwei Jahren Bundeskanzler, die Terroranschläge des 11. September hatten noch nicht stattgefunden und auf das erste iPhone mußte man noch sieben Jahre warten – startete ich an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit dem Diplomstudiengang Geologie/Paläontologie, bevor ich im Sommersemester 2002 vom Coesfelder Kreuz an den Domplatz, von den Natur- in die Geisteswissenschaften wechselte, hin zur Deutschen Philologie, Allgemeinen Sprachwissenschaft sowie zur Neueren und Neuesten Geschichte auf Magister. (Privat zog ich vom Gievenbecker Nienborgweg, 2000-2009, zur Annenstraße am Südpark, 2009-2010, schließlich in die Von-Einem-Straße vor den Toren Kinderhaus’, 2010-2012.) Grund genug, an diesem runden Jahrestag als Alumnus einen Blick in mein grünes Studienbuch zu werfen und die seinerzeit noch handschriftlich ausgefüllten Belegbögen der einzelnen Semester ins Digitale und Globale zu überführen.
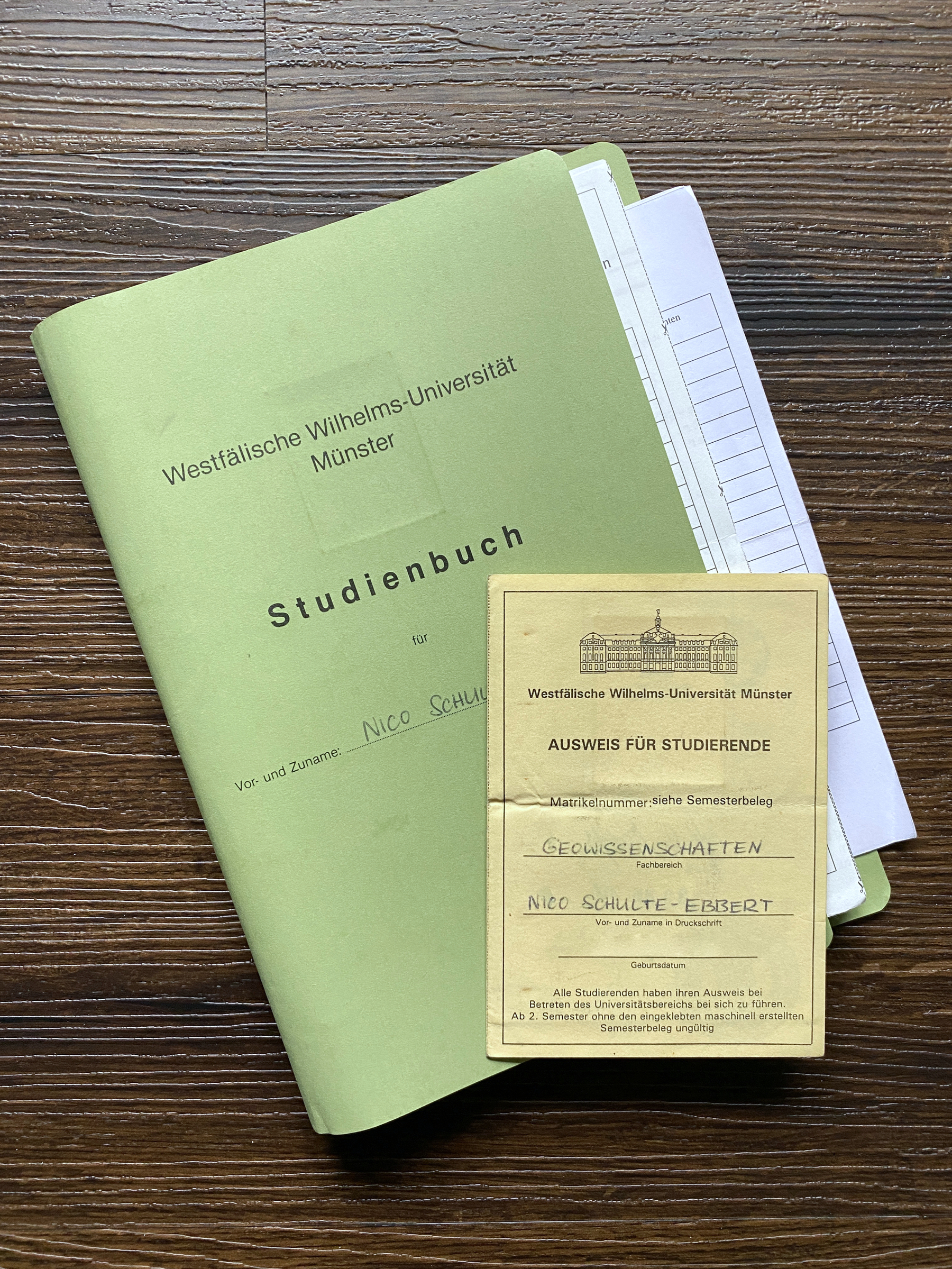 Studienbuch und Ausweis für Studierende
Studienbuch und Ausweis für Studierende
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)
- BS = Blockseminar
- HS = Hauptseminar
- Ko = Kolloquium
- (L)K = (Lektüre-)Kurs
- OS = Oberseminar
- PS = Proseminar
- Ü = Übung
- VL = Vorlesung
Wintersemester 2000/2001: Diplomstudium
 Wo alles begann: Das Institut für Geologie und Paläontologie der WWU Münster, Corrensstr. 24
Wo alles begann: Das Institut für Geologie und Paläontologie der WWU Münster, Corrensstr. 24
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)
144204
Allgemeine Geologie – Exogene Dynamik (VL)
Heinrich Bahlburg
Mo-Do, 09:15-10:00, HS 2, IG I
144147
Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (VL)
Friedrich Strauch
Mo-Di, 10:00-11:00, HS 3, IG I
120788
Allgemeine Chemie und Einführung in die anorganische Chemie für Chemiker (Diplom und Lehramt), Lebensmittelchemiker, Pharmazeuten (1. Sem. AAppO) und weitere Naturwissenschaftler (VL)
Franz Ekkehardt Hahn
Mo-Fr, 12:00-13:00, C 1
120630
Theoretische Übungen zur Vorbereitung auf das anorganisch-chemische Praktikum für Biologen und Landschaftsökologen (Diplom) (Ü)
Hans-Dieter Wiemhöfer
Mo 18:00-20:00, C 1
110188
Physik für Naturwissenschaftler I (VL)
Heinrich Franz Arlinghaus
Di, Do, Fr, 08:00-09:00, HS 1, IG I
144132
Übungen zur Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (Ü)
F. Stiller
Do, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24
Sommersemester 2001: Diplomstudium
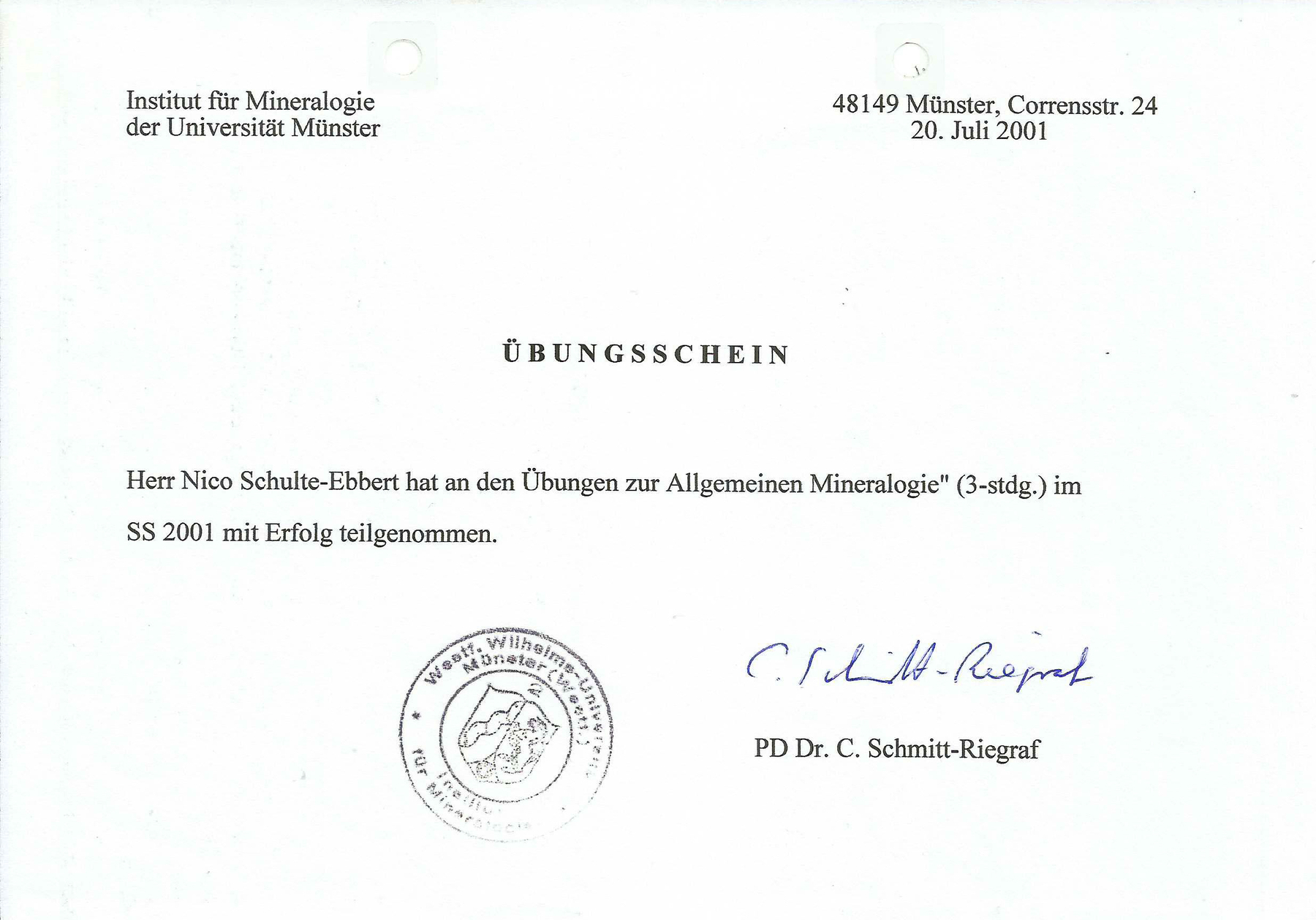 Der erste Übungsschein: »mit Erfolg«
Der erste Übungsschein: »mit Erfolg«
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2001)
140204
Allgemeine Landschaftsökologie (VL)
Friedrich-Karl Holtmeier
Mo-Do, 08:00-09:00, Hörsaal Robert-Koch-Str. 26
143969
Einführung in die Paläobotanik (VL, Ü)
Hans Kerp
Mo, 14:00-17:00, SR Paläobotanik, Hindenburg-Platz 57
143901
Übungen zur Geologischen Karte (Ü)
Heiko Zumsprekel
Mi, 10:00-12:00, SR G, IG I
144750
Allgemeine Mineralogie (VL, Ü)
Cornelia Schmitt-Riegraf, Jürgen Löns
Mi, 12:00-14:00, Do, 11:00-13:00, Fr. 12:00-14:00, HS 2, IG I
140219
Allgemeine Landschaftsökologie (Ü)
Brauckmann
Do, Robert-Koch-Str. 26
Schriftliche Ausarbeitungen
- Protokoll zu den Geländetagen im westlichen Teutoburgerwald, 14.-16.06.01
 Wuchtig: Die Institutsgruppe I in der Wilhelm-Klemm-Str. 10, in der ein Großteil der Veranstaltungen stattfand
Wuchtig: Die Institutsgruppe I in der Wilhelm-Klemm-Str. 10, in der ein Großteil der Veranstaltungen stattfand
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)
Wintersemester 2001/2002: Diplomstudium
140423
Allgemeine Hydrogeologie (VL)
Wilhelm G. Coldewey
Mo, 11:00-13:00, HS 3, IG I
141276
Spezielle Mineralogie und Einführung in die Petrologie (VL)
Christian Ballhaus
Mo, 13:00-16:00, SR E, IG I
140208
Einführung in die Tektonik (Tektonik I) (VL, Ü)
Eckard Speetzen
Mi, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24
141280
Mineral- und Gesteinsbestimmungen (Ü)
Christian Ballhaus
Fr, 11:00-14:00, SR E, IG I
080??
Einführung in die lateinische Sprache I (Ü)
Gotthard Schmidt
Vierstündig, HS 220, Pferdegasse 3
Sommersemester 2002: Magisterstudium
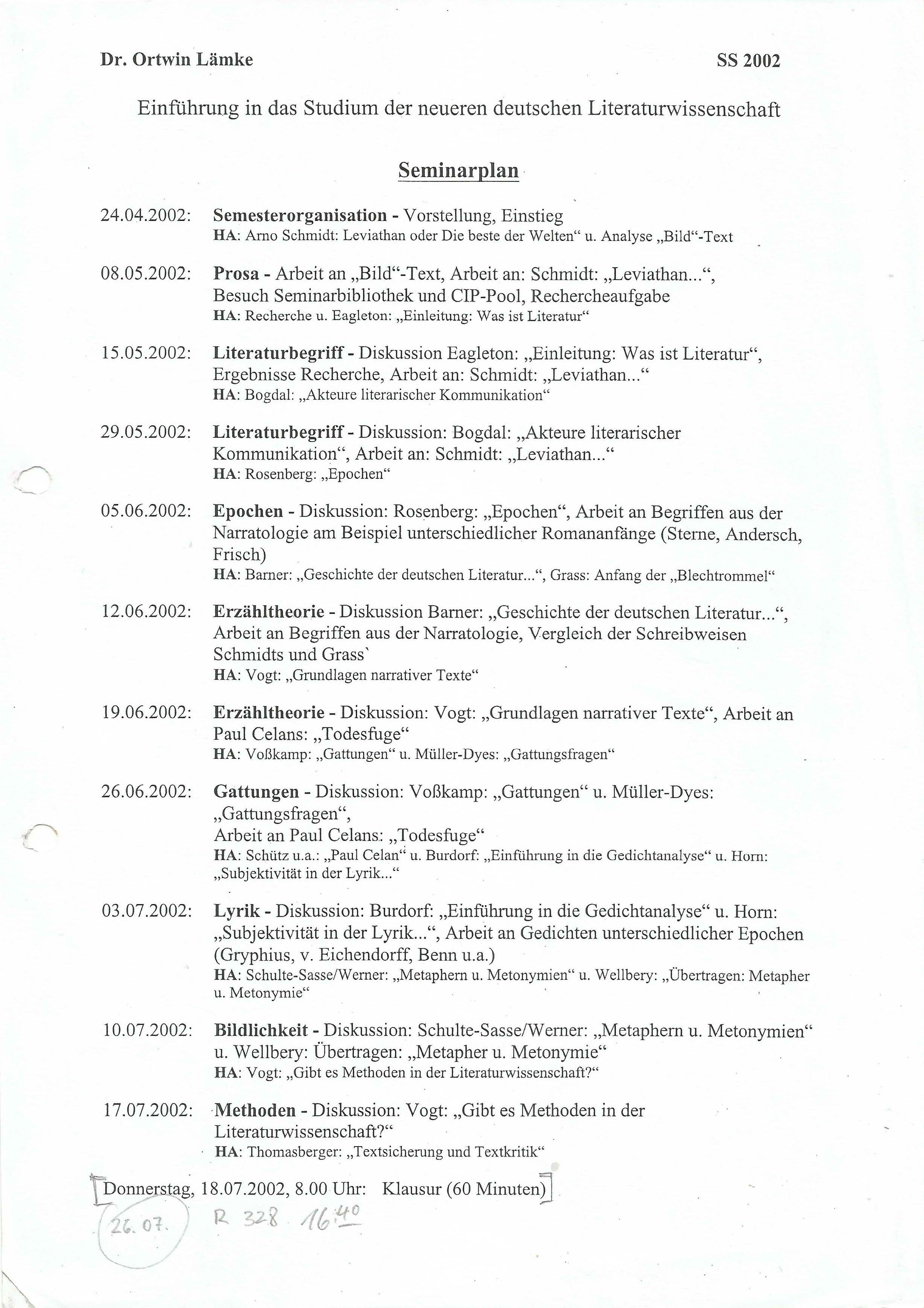 Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Der erste Seminarplan
Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Der erste Seminarplan
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2002)
090204
Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft (PS)
Benjamin Stoltenburg
Mo, 10:00-12:00, J 121
080742
Einführung in die lateinische Sprache II (Ü)
Gotthard Schmidt
Mo, 16:00-18:00, S 6; Do, 16:00-18:00, S 2
090075
Kasusphänomene des Deutschen (VL)
Rudolf Schützeichel
Di, 09:00-10:00, J 12
081112
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Reisen in der alten Welt (PS)
Hans-Christian Schneider
Di, 16:00-18:00, F 10; Mi, 12:30 s.t.-14:00, R 232, Fürstenberghaus
091177
Einführung in das Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft (PS)
Ortwin Lämke
Mi, 09:00-11:00, R 20, Fürstenberghaus
097979
Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft II (Ü)
Hartwig Franke
Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3
080871
Geschichte des westlichen Mittelmeerraumes (bis zum Ende des Zweiten Punischen Krieges) (VL)
Norbert Ehrhardt
Do, Fr, 10:00-11:00, R 232, Fürstenberghaus
090018
Einführungsvorlesung für Erst- und Zweitsemester in allen Studiengängen (VL)
S. Günthner, V. Honemann, J. Macha, E. Rolf, J. Splett, H. Kraft
Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20
Referate und Seminararbeiten
- Textuntersuchung zu Arno Schmidts »Leviathan oder Die beste der Welten« unter der Fragestellung »Ist der Ich-Protagonist religiös?«
- Rechercheaufgabe: Georg Büchner
- (Zusammen mit Linda Kutt und Alexander Keil) Die Reisen des Apostels Paulus
Wintersemester 2002/2003: Magisterstudium
 Ceci n’est pas un baron: Die Statue Freiherr von Fürstenbergs vor dem Fürstenberghaus, in dem ein Großteil der Veranstaltungen stattfand
Ceci n’est pas un baron: Die Statue Freiherr von Fürstenbergs vor dem Fürstenberghaus, in dem ein Großteil der Veranstaltungen stattfand
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)
080784
Einführung in die lateinische Sprache III (Ü)
Gotthard Schmidt
Mo, Do, 09:00-11:00, S 2
090102
Rhetorik und Kultur (VL)
Martina Wagner-Egelhaaf
Mo, 16:00-18:00, J 12
097949
Narrativik und Textlinguistik (VL)
Edeltraud Bülow
Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a
080985
Das Reich in der Krise: Deutsche Geschichte von 1250 bis 1350 (VL)
Heike Johanna Mierau
Di, 14:00-16:00, Fürstenberghaus
091295
Heinrich von Kleist (PS)
Ortwin Lämke
Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus
097968
Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft I (Ü)
Hartwig Franke
Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3
081192
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Menschen und ihre Umwelt im Mittelalter (PS)
Thomas Scharff
Do, 14:00-16:00, R 32, Georgskommende 14; Fr, 11:00-13:00, R 1, Georgskommende 14
09xxxx
Tutorium zur Einführungsübung Allgemeine Sprachwissenschaft (Ü)
Robert Memering, Nicki Marten
Do, 16:00-18:00, Institut Bergstr. 29a
090299
Einführung in die Analyse der deutschen Gegenwartssprache (PS)
Götz Hindelang
Do, 18:00-20:00, J 122
090011
Einführungsvorlesung für Erstsemester in den Studiengängen SI/SII/Magister (VL)
T. Althaus, V. Honemann, A. Kilcher, L. Köhn, H. Kraft, D. Kremer, E. Ribbat, M. Wagner-Egelhaaf
Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20
Referate und Seminararbeiten
- (Zusammen mit Julia Frenking) Moderation: Semiotik (Wellbery); Referat: Das Käthchen von Heilbronn (1810)
- Gustav, Toni und ›die Neger‹ – Über die Farb- und Lichtmetaphorik in Heinrich von Kleists »Die Verlobung in St. Domingo«
- (Zusammen mit Ute Aben) Das mittelalterliche Weltbild – Raumvorstellungen und Vorstellungen von der Erde
Sommersemester 2003: Magisterstudium
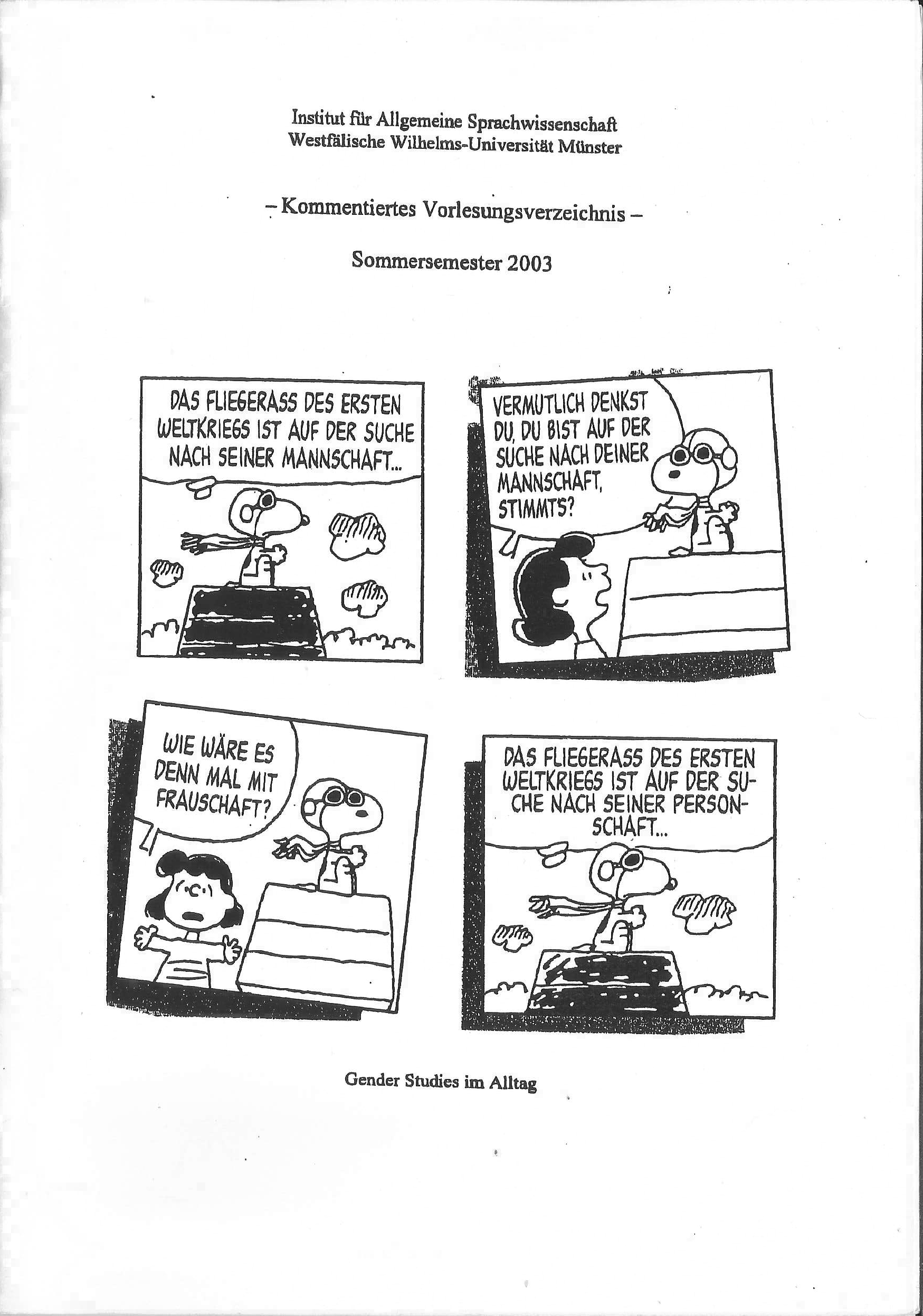 »Gender Studies im Alltag.« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft
»Gender Studies im Alltag.« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2003)
097990
Einführung in die Beschreibungskonventionen der neueren generativen Syntaxtheorie (PS)
Heinz Alfred Bertz
Mo, 14:00-16:00, Institut Bergstr. 29a
097947
Grundzüge der Pragmalinguistik (VL)
Edeltraud Bülow
Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a
090100
Deutsche Literatur – ein Kanon I (VL)
Ernst Ribbat
Di, 16:00-18:00, Audimax
090388
Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen (PS)
Hans-Jörg Spitz
Mi, 08:00-10:00, J 121
091370
Albert Ehrenstein (PS)
Andreas Kilcher
Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus
081444
Das mittelalterliche Königtum: Rechte, Pflichten, Herrschaftspraxis (K)
Gerd Althoff
Mi, 14:00-16:00, R 1, Georgskommende 14
090115
Jean Paul: Variationen des Romans (VL)
Andreas Kilcher
Do, 09:00-11:00, J 12
081152
Die Zerstörung der Weimarer Demokratie (Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert) (VL)
Ernst Laubach
Do, 11:00-13:00, S 1
097985
Morphologie (PS)
Hartwig Franke
Fr, 09:00-11:00, Institut Bergstr. 29a
Referate und Seminararbeiten
- Albert Ehrenstein: Tubutsch – Kontext und Rezeption
- »Der ewige Jude« – Albert Ehrensteins Ahasver-Figur im Vergleich mit anderen literarischen Adaptionen
- Adjektivflexion der isolierenden, flektierenden, agglutinierenden und inkorporierenden Sprachtypen
Wintersemester 2003/2004: Magisterstudium
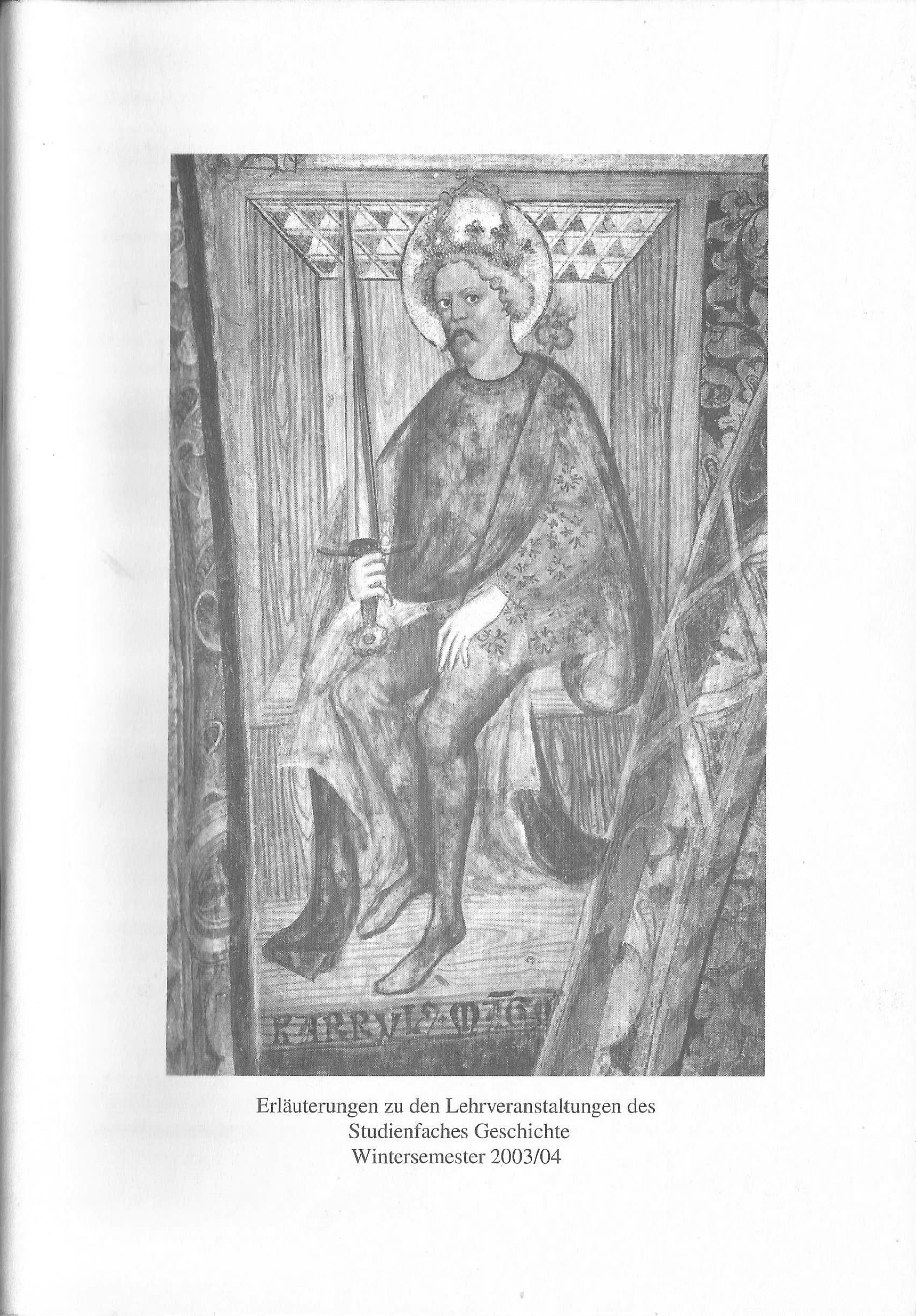 »Karl der Große. Fresko im Kreuzgang des Doms von Brixen (Bressanone).« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Historischen Seminars
»Karl der Große. Fresko im Kreuzgang des Doms von Brixen (Bressanone).« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Historischen Seminars
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2003)
081103
Geschichte und Zukunft der Globalisierung (VL)
Stefan Haas
Mo, 16:00-18:00, F 3
090487
Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht (PS)
Henning von Gadow
Di, 10:00-12:00, J 121
097940
Psycholinguistik und kognitive Linguistik (VL)
Edeltraud Bülow
Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a
090119
Deutsche Literatur – ein Kanon II (VL)
Ernst Ribbat
Di, 16:00-18:00, Audimax
081319
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Revolution von 1848 in West und Ost (PS)
Lothar Maier
Di, 18:00-20:00, F 2a; Mi, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14
097936
Arten und Formen der Deixis (VL)
Clemens-Peter Herbermann
Mi, Do, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a
090510
Semantik (PS)
Susanne Beckmann
Do, 12:00-14:00, J 120
090104
Die Heidelberger Romantik (VL)
Andreas Kilcher
Do, 14:00-16:00, J 12
090070
Metaphern im Kontext/Kontexte der Metapher (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, J 12
098033
Eigennamen und Referenztheorie (PS)
Clemens-Peter Herbermann
Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a
Referate und Seminararbeiten
- Die Menschenrechte: Erfindung der Frankfurter Paulskirche?
- Die Verarbeitung von Eigennamen (EN) und Gattungsbezeichnungen (GB)
- (Zusammen mit Johannes B. Finke) ReFraming. Eine zusammenfassende, kritische Betrachtung der linguistisch orientierten Frametheorie (unter besonderer Berücksichtigung der Konzeption K.-P. Konerdings)
Sommersemester 2004: Magisterstudium
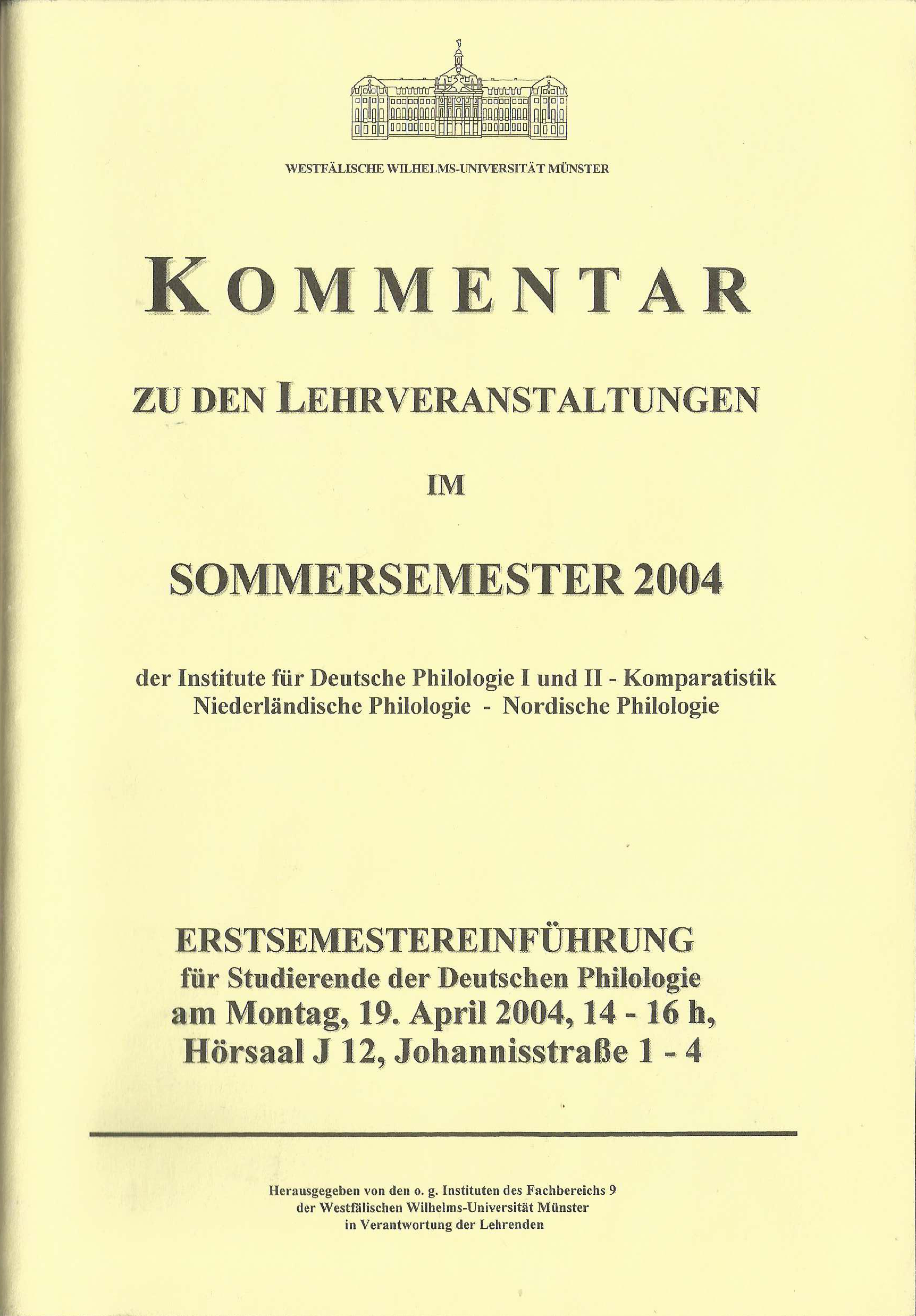 Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses der Institute für Deutsche Philologie I und II, Komparatistik, Niederländische Philologie und Nordische Philologie
Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses der Institute für Deutsche Philologie I und II, Komparatistik, Niederländische Philologie und Nordische Philologie
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2004)
081575
Geschichte des Films (HS)
Stefan Haas
Mo, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14
08????
Geschichte der visuellen Kultur am Beispiel des Films (VL)
Stefan Haas
Mo, 16:00-18:00, F 3
090102
Geschichte der deutschen Literatur: Klassik und Romantik (VL)
Detlef Kremer
Di, 10:00-12:00, J 12
097934
Kommunikation und Metakommunikation. Beiträge zu einer Metalinguistik (VL)
Edeltraud Bülow
Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a
090079
Schaubühne der Aufklärung: Theater 1730-1780 (VL)
Thomas Althaus
Mi, 11:00-13:00, J 12
091443
Heiner Müllers Medea Material (HS)
Karl Heinrich Hucke
Do, 09:00-11:00, Studiobühne
090743
Jacques Derrida (LK)
Rebecca Branner
Do, 12:00-14:00, J 120
082423
Grundkurs Theoretische Philosophie II: Einführung in die Erkenntnistheorie (VL)
Oliver R. Scholz
Do, 14:00-16:00, F 3
Referate und Seminararbeiten
- Der »Medea«-Mythos: Herrschaftsstrukturen in den Adaptionen Euripides’ und Müllers
- Ausstattungen eines Mythos: Die Medea Euripides’, Ovids und Senecas im Vergleich
- Die Systematisierung der Konfusion: Surrealistische Tendenzen in »Magical Mystery Tour«
Wintersemester 2004/2005: Magisterstudium
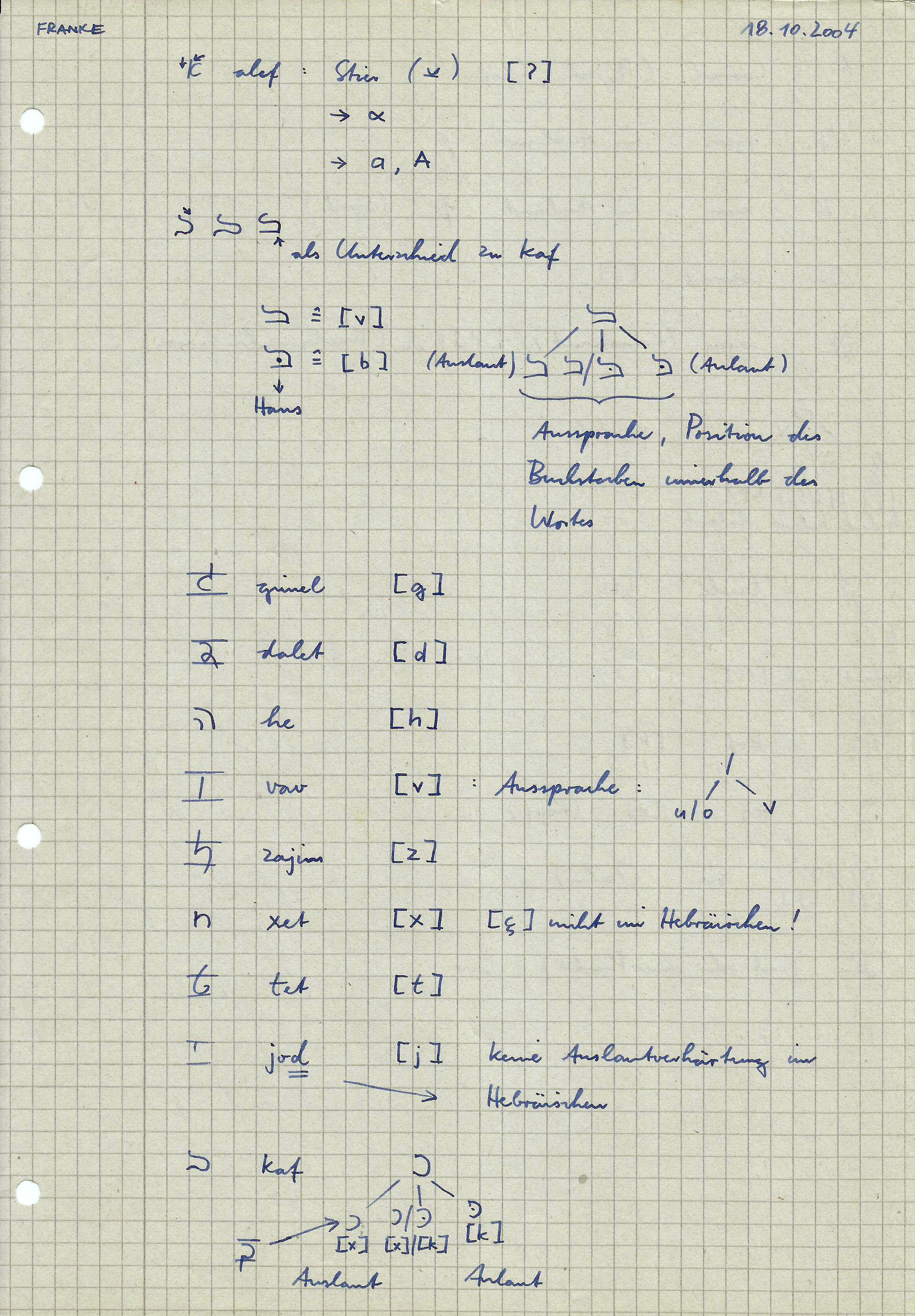 Beinahe kafkaesk: Aufzeichnungen aus der Hebräisch-Stunde
Beinahe kafkaesk: Aufzeichnungen aus der Hebräisch-Stunde
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2004)
09????
Hebräisch (Ü/BS)
Hartwig Franke
Mo, 09:00-11:00 (Ü bis 25.11.04, dann BS 06.-08.01.05), Institut Bergstr. 29a
080960
Nordamerika in der europäischen Weltwirtschaft, 17.-20. Jahrhundert (VL)
Georg Fertig
Mo, 16:00-18:00, F 3
090091
Dispositive der Sichtbarkeit (VL)
Detlef Kremer, Martina Wagner-Egelhaaf
Di, 10:00-12:00, J 12
091633
Einführung in die ästhetischen Schriften Walter Benjamins und Theodor W. Adornos (LK)
Renate Werner
Di, 14:00-16:00, F 9
097942
Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen (VL)
Clemens-Peter Herbermann
Mi, Do, Fr, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a
081325
Widerstand gegen den König im frühen und hohen Mittelalter. Legitimation, Organisationsformen, Konsequenzen (K)
Gerd Althoff
Mi, 14:00-16:00, F 5
091490
Text – Bild – Bewegungsbild (HS)
Detlef Kremer
Do, 11:00-13:00, Studiobühne
090053
Symboltheorien (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, J 12
098088
Satzglieder und Satzgliedfunktionen - Zur Informationsstruktur des Satzes (HS)
Clemens-Peter Herbermann
Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a
Vortrag
Sprache, Gene, Archäologie und die Vorgeschichte Europas
Bernard Comrie
Mi, 08.12.04, 18:00-20:00, J 122
Referate und Seminararbeiten
- Die Tradition der Begriffspaare »Subjekt/Prädikat« sowie »Thema/Rhema« von Hermann Paul bis Karl Boost
- Der medientechnische Wahrnehmungswandel: Über den Einfluss der Fotografie auf die Literatur
- (Zusammen mit Lars Köllner) Roland Barthes: Der lesbare Text und die Lust am Text
- (Zusammen mit Lars Köllner und Stephan Lütke Hüttmann) Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer
Sommersemester 2005: Magisterstudium
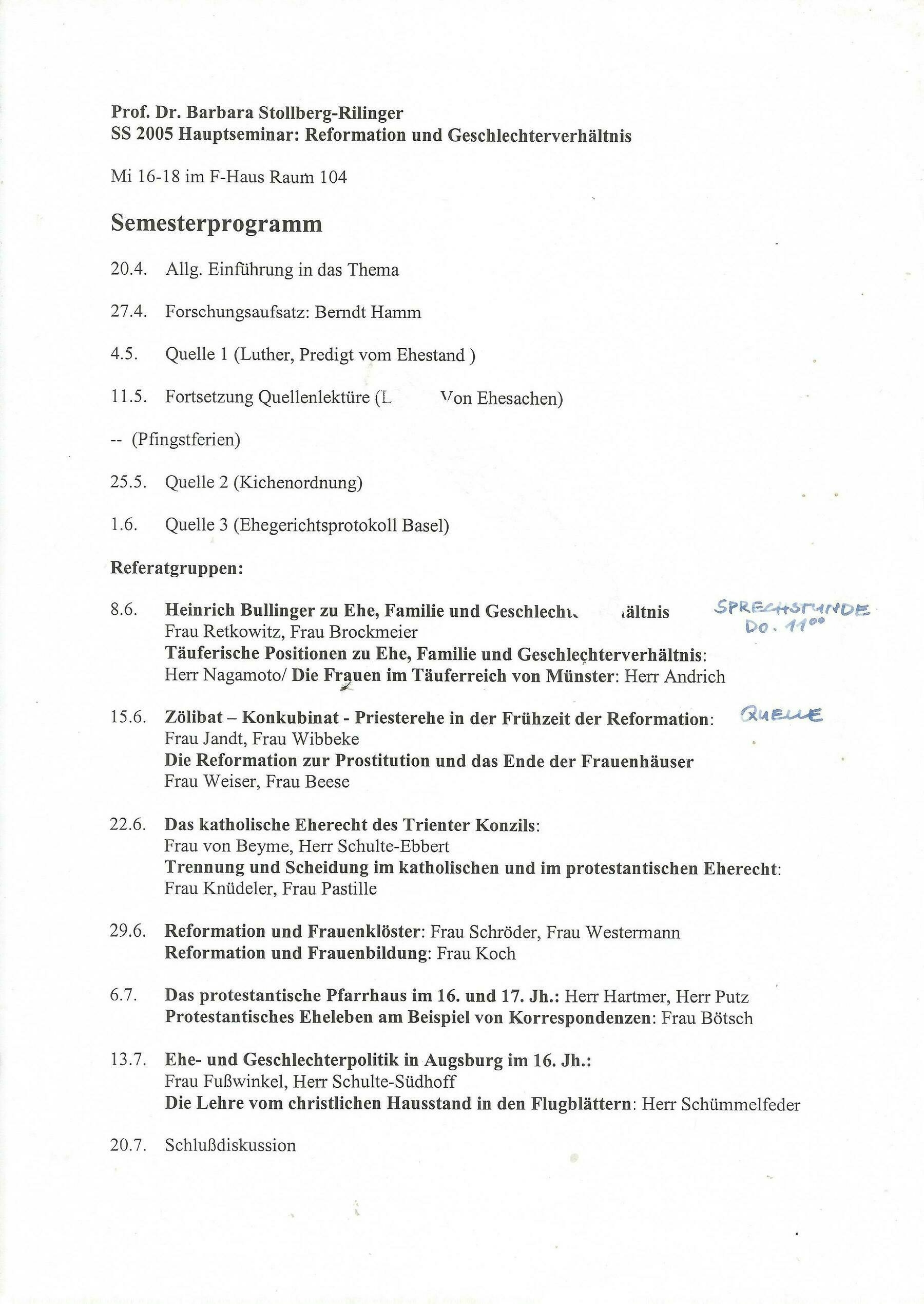 Semesterprogramm und Referatsthemen des Hauptseminars »Reformation und Geschlechterverhältnis«
Semesterprogramm und Referatsthemen des Hauptseminars »Reformation und Geschlechterverhältnis«
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2005)
091756
Ästhetik des Raums. Raumkonfigurationen in der Literatur seit 1800 und im Film (VL)
Detlef Kremer
Mo, 11:00-13:00, J 12
091737
Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts (VL)
Eric Achermann
Mo, 13:00-15:00, J 12
090544
Der Sprachgebrauch in den Medien (HS)
Franz Hundsnurscher
Mo, 18:00-20:00, J 122
081031
Ursprünge der Globalisierung: Die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft, ca. 1500-1850 (VL)
Ulrich Pfister
Di, 12:00-14:00, F 2
081926
Lektüre und Interpretation niederrheinischer Quellen der Frühen Neuzeit (Ü)
Johannes Schreiner
Di, 18:00-20:00, R 32, Georgskommende 14
097940
Sprachliche Universalien – Geschichte und Theorie eines linguistischen Forschungszweigs (VL)
Clemens-Peter Herbermann
Mi, 10:00-11:00, Institut Aegidiistr. 5
081600
Reformation und Geschlechterverhältnis (HS)
Barbara Stollberg-Rilinger
Mi, 16:00-18:00, R 104, Fürstenberghaus
081027
Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit (VL)
Barbara Stollberg-Rilinger
Do, 09:00-11:00, S 1
098086
Universalienforschung zur Semantik und zur sprachlichen Symbolisierung (HS)
Clemens-Peter Herbermann
Do, 11:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5
090032
Symboltheorien II (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, J 12
Referate und Seminararbeiten
- Die Pressekritik von Karl Kraus: Indexikalisierung und konservative Sprachhygiene
- Was bedeutet blau_? Zur Semantik der Grundfarbwörter als sprachliche Universalie_
- (Zusammen mit Matthias Hahn) Anna Wierzbicka: The meaning of color terms
- (Zusammen mit Evelyne v. Beyme) Das katholische Eherecht des Trienter Konzils
Wintersemester 2005/2006: Magisterstudium
 Das Landhaus Rothenberge, in dem nicht nur diskutiert, sondern auch Tischtennis gespielt wurde
Das Landhaus Rothenberge, in dem nicht nur diskutiert, sondern auch Tischtennis gespielt wurde
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2005)
091233
Klassiker des Strukturalismus (Ü)
Eric Achermann
Mo, 16:00-18:00, R 124, Leonardo-Campus
090844
Mediendiskursanalyse (VL)
Ekkehard Felder
Di, 18:00-20:00, R 3, Leonardo-Campus
090940
Sprache und Kultur (VL)
Susanne Günthner
Mi, 12:00-14:00, J 12
091070
Mimesis und Fiktion (VL)
Eric Achermann
Mi, 14:00-16:00, J 12
091090
Einführung in die Texttheorie (historisch) (VL)
Moritz Baßler
Do, 10:00-12:00, J 12
091248
Einführung in die Texttheorie (LK)
Moritz Baßler
Do, 12:00-14:00, F 4
09????
Word & World. Practice and the Foundations of Language (BS)
Eckard Rolf
Mo-Mi, 17.-19.10.05, Landhaus Rothenberge
Referate und Seminararbeiten
Verfassen eines Exposés zur Magisterarbeit
Sommersemester 2006: Magisterstudium
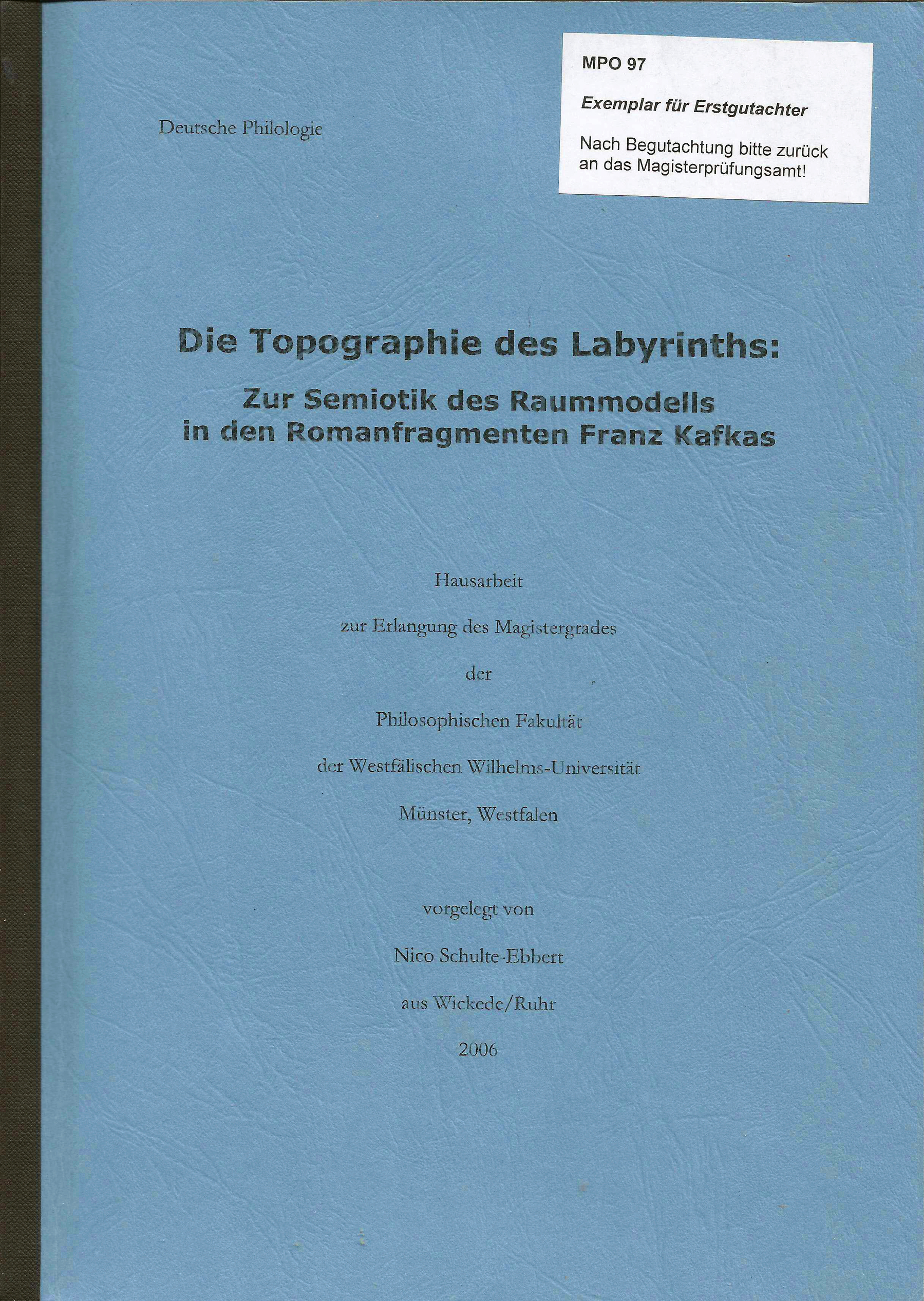 Titelblatt meiner Magisterarbeit: Exemplar des Erstgutachters Detlef Kremer
Titelblatt meiner Magisterarbeit: Exemplar des Erstgutachters Detlef Kremer
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2006)
Keine belegten Veranstaltungen
Abgabe der Magisterarbeit, Juni 2006
Themen der mündlichen Prüfungen, September/Oktober 2006
- Jean Paul: Theorie und Praxis
- Schrift/Text, Bild, Bewegungsbild
- Semiotik (unter besonderer Beachtung der Zeichentheorie Ch. S. Peirce’)
- Eigennamentheorie
- Deixis-Theorie
- Die Revolution von 1848: Frankreich und ›Deutschland‹ im Vergleich
- Die Darstellung des Holocaust im Spielfilm: »Schindlers Liste« und »Das Leben ist schön«
Wintersemester 2006/2007: Magisterstudium
 Das Fürstenberghaus am Domplatz 20-22, vom Jesuitengang aus gesehen, in dem damals auch noch die germanistische Institutsbibliothek beheimatet war
Das Fürstenberghaus am Domplatz 20-22, vom Jesuitengang aus gesehen, in dem damals auch noch die germanistische Institutsbibliothek beheimatet war
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2007)
Keine belegten Veranstaltungen
Vorbereitung eines Exposés zur Dissertation
Sommersemester 2007: Promotionsaufbaustudium
 Studierendenausweis/Semesterticket für das Sommersemester 2007
Studierendenausweis/Semesterticket für das Sommersemester 2007
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2007)
090772
Positionen der Medientheorie (VL)
Detlef Kremer
Mo, 16:00-18:00, J 12
091620
Ästhetische Selbstreferenz (VL)
Achim Hölter
Di, 10:00-12:00, J 12
090127
Grammatik der deutschen Sprache (Ü)
Götz Hindelang
Do, 12:00-14:00, J 121
090533
Syntax der deutschen Gegenwartssprache (VL)
Eckard Rolf
Do, 16:00-18:00, J 12
091434
Sprachtheorien (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, J 12
092134
Thomas Bernhard: Ausgewählte Prosa (BS)
Wolfgang Bender
Mo-Di, 16.-24.07.07, Fürstenberghaus
Referate und Seminararbeiten
- Spazierengehen/Schreibengehen/Lesengehen. Dekonstruktive Lektüre(n) zu Thomas Bernhards Gehen
Wintersemester 2007/2008: Promotionsaufbaustudium
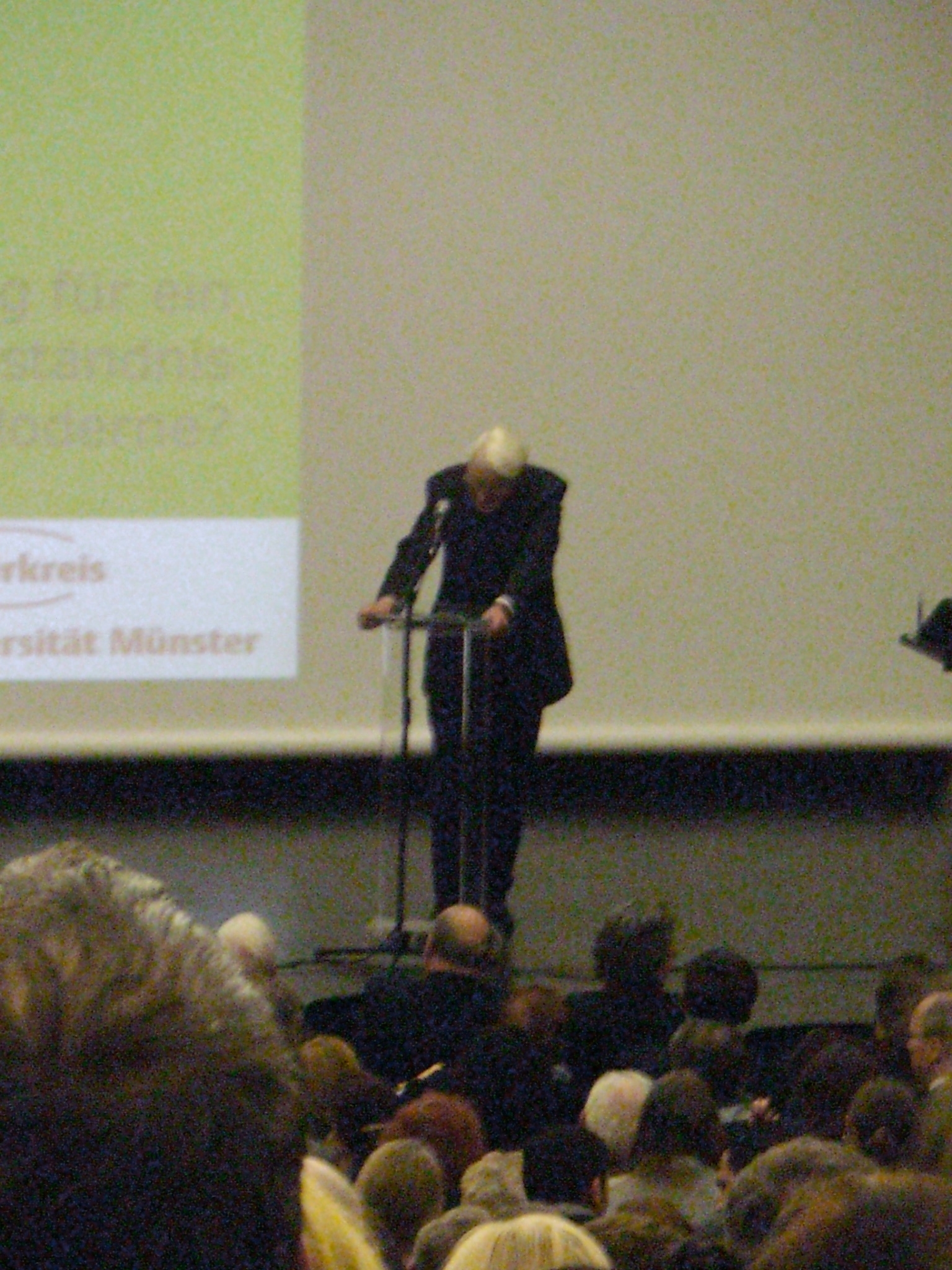 Der 78jährige Jürgen Habermas während seines Vortrags im Hörsaal H 1
Der 78jährige Jürgen Habermas während seines Vortrags im Hörsaal H 1
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2008)
097933
Sprachphilosophie und/oder/als Neurophilosophie? (VL)
Edeltraud Bülow
Di, 12:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5
092305
Zeichentheorie (OS)
Eric Achermann
Di, 18:00-20:00, SR 1, Fürstenberghaus
084205
Einführung in die Erkenntnistheorie (VL)
Andreas Hüttemann
Mi, 10:00-12:00, PC 7
090556
Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (I) (VL)
Achim Hölter
Mi, 12:00-14:00, PC 7
091969
Zur Beziehung von Text und Bild. Geschichte und Theorie (VL)
Eric Achermann, Tomas Tomasek
Mi, 14:00-16:00, J 12
091476
Sprachtheorien II (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, J 12
Vortrag
Die Revitalisierung der Weltreligionen. Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne?
Jürgen Habermas
Mi, 30.01.08, 18:00-20:00, H 1
Referate und Seminararbeiten
- (Zusammen mit Evelyne v. Beyme) Charles Sanders Peirce (1839-1914)
Sommersemester 2008: Promotionsaufbaustudium
 Auszug aus meinen Mitschriften der Vorlesung »Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie« von Eckard Rolf sowie des Vortrags »Roland Barthes. Literarische Szenographien der Gesellschaft« von Marion Bönnighausen, gehalten im Rahmen der Ringvorlesung »In(ter)ventionen. Literatur – Gesellschaft – Politik«
Auszug aus meinen Mitschriften der Vorlesung »Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie« von Eckard Rolf sowie des Vortrags »Roland Barthes. Literarische Szenographien der Gesellschaft« von Marion Bönnighausen, gehalten im Rahmen der Ringvorlesung »In(ter)ventionen. Literatur – Gesellschaft – Politik«
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2008)
090884
Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, J 12
084390
Einführung in die Sprachphilosophie (VL)
Rosemarie Rheinwald
Fr, 14:00-16:00, Fürstenberghaus
Referate und Seminararbeiten
Weder noch
Wintersemester 2008/2009: Promotionsaufbaustudium
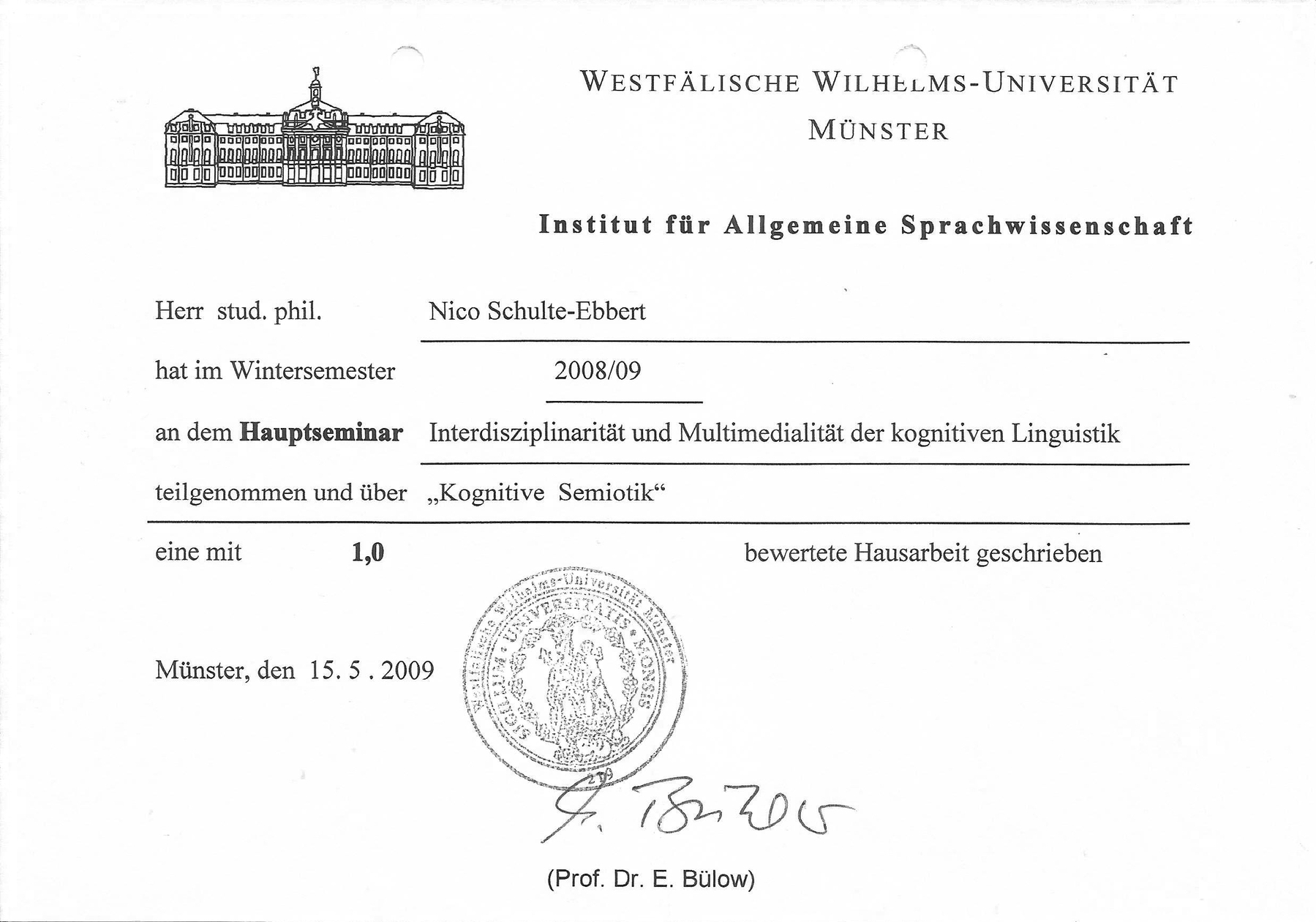 Zwar nicht der letzte Schrei, dafür jedoch der letzte Schein
Zwar nicht der letzte Schrei, dafür jedoch der letzte Schein
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2009)
098310
Kognitive Linguistik. Grundlagen und Perspektiven (VL)
Edeltraud Bülow
Mo, 09:00-10:00, Institut Aegidiistr. 5
098324
Interdisziplinarität und Multimedialität der kognitiven Linguistik (HS)
Edeltraud Bülow
Mo, 10:00-12:00, Institut Aegidiistr. 5
090979
Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (III) (VL)
Achim Hölter
Mi, 14:00-16:00, F 2
092307
Bedeutungstheorien – Theories of Meaning (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, J 12
084795
Mensch und Kultur (VL)
Spree
Fr, 10:00-12:00, S 2
Referate und Seminararbeiten
- Kognitive Semiotik. Versuch einer Beschreibung mentaler Repräsentationen vermittels der zeichentheoretisch-pragmatizistischen Überlegungen Charles Sanders Peirce’
Sommersemester 2009: Promotionsaufbaustudium
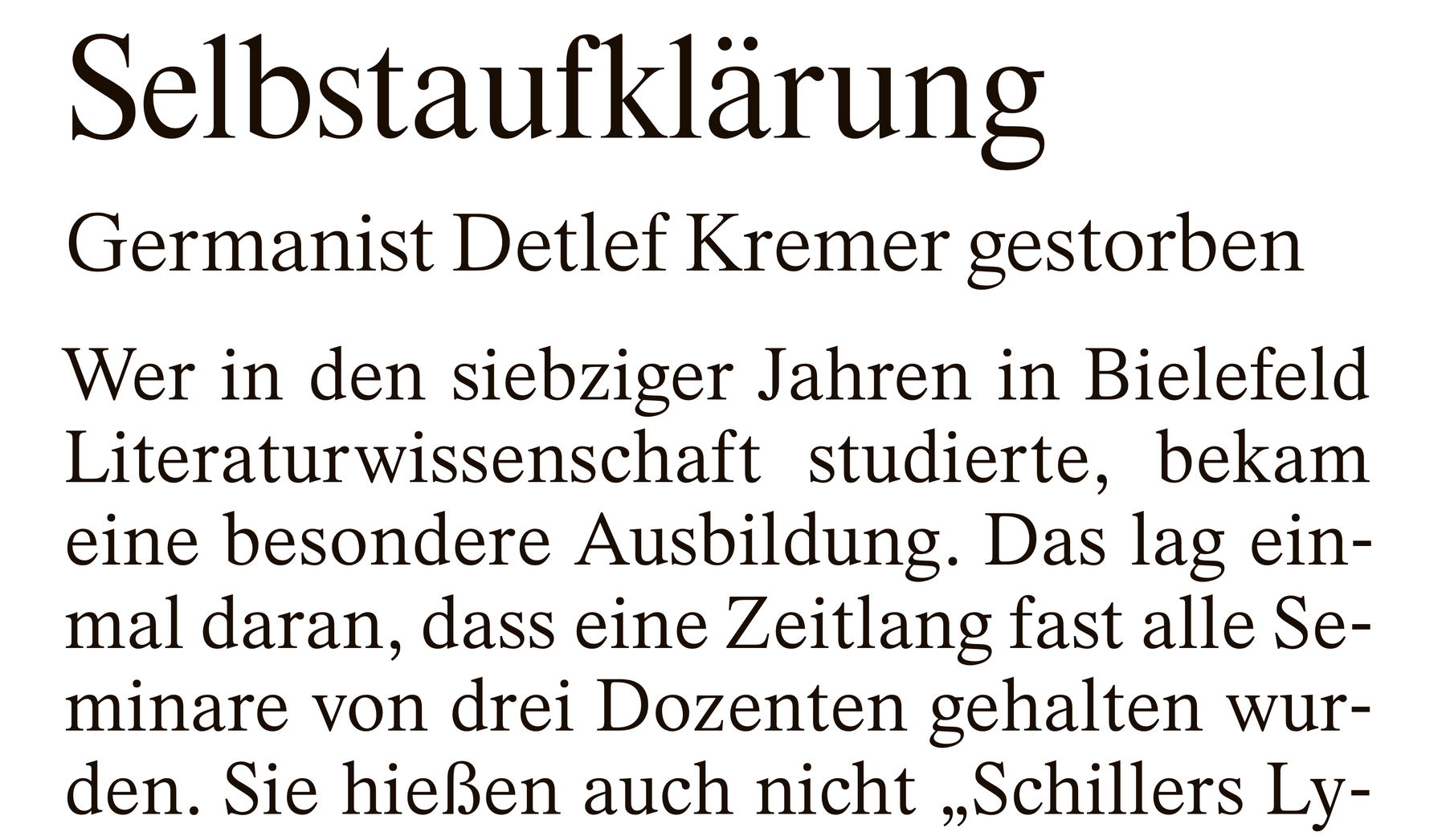 Beginn von Jürgen Kaubes Nachruf auf meinen Doktorvater Detlef Kremer, der am 3. Juni 2009 völlig überraschend gestorben ist.
Beginn von Jürgen Kaubes Nachruf auf meinen Doktorvater Detlef Kremer, der am 3. Juni 2009 völlig überraschend gestorben ist.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.06.2009, p. 34)
084167
Einführung in die Metaphysik (VL)
Oliver R. Scholz
Do, 16:00-18:00, F 2
091605
Bedeutungstheorien II – Theories of Meaning II (VL)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, R 118, Vom-Stein-Haus
Referate und Seminararbeiten
Weder noch
Wintersemester 2009/2010: Promotionsaufbaustudium
 Hörsaal im Münsteraner Schloß
Hörsaal im Münsteraner Schloß
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2010)
092131
Doktorandenkolloquium (Ko)
Eckard Rolf
Do, 18:00-20:00, R 010, Vom-Stein-Haus
Vortrag
Language and Social Ontology
John R. Searle
Di, 08.12.09, 20:00-22:00, Audimax
Sommersemester 2010: Promotionsaufbaustudium
Keine belegten Veranstaltungen
Wintersemester 2010/2011: Promotionsaufbaustudium
 Im Büro Eckard Rolfs im Vom-Stein-Haus fand der Lektürekurs zu Hans Blumenbergs »Arbeit am Mythos« statt
Im Büro Eckard Rolfs im Vom-Stein-Haus fand der Lektürekurs zu Hans Blumenbergs »Arbeit am Mythos« statt
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011)
090025
Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft (VL)
Eric Achermann
Mo, 16:00-18:00, Fürstenberghaus
09???? (semi-offiziell, im kleinen Kreis)
Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos (LK)
Eckard Rolf
Do, R 010, Vom-Stein-Haus
Sommersemester 2011: Promotionsaufbaustudium
Softwareschulungen am ZIV:
Excel I: Einsteigerkurs
Mo, 18.04.11, vierstündig, Einsteinstr. 60
Photoshop I: Einsteigerkurs
Di, 19.04.11, vierstündig, Einsteinstr. 60
Layouten mit InDesign
Mi, Do, 18./19.05.11, achtstündig, Einsteinstr. 60
Wintersemester 2011/2012: Promotionsaufbaustudium
Keine belegten Veranstaltungen
Sommersemester 2012: Promotionsaufbaustudium
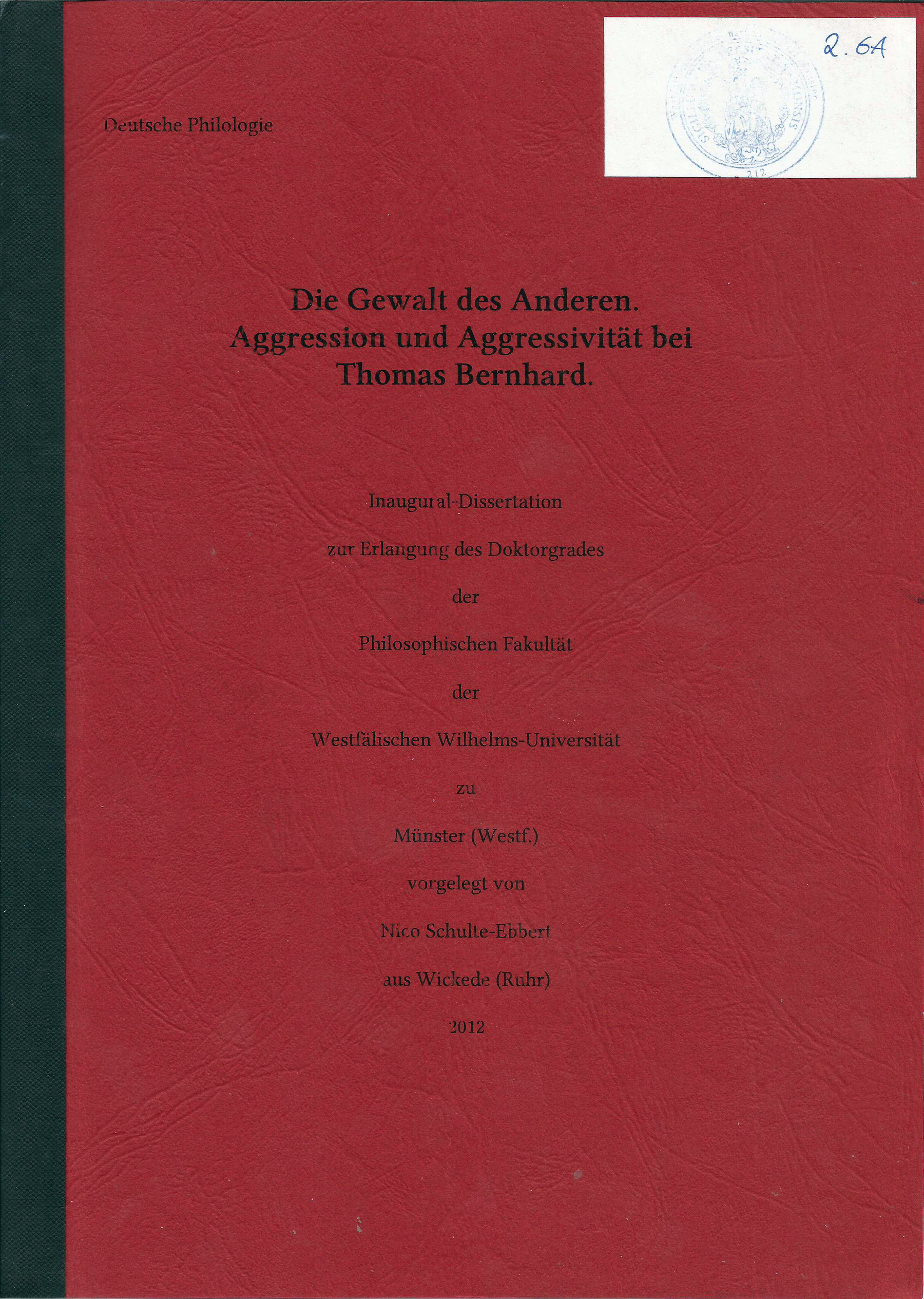 Titelblatt meiner Dissertation: Exemplar der Zweitgutachterin Cornelia Blasberg
Titelblatt meiner Dissertation: Exemplar der Zweitgutachterin Cornelia Blasberg
(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2012)
Keine belegten Veranstaltungen
Einreichung der Dissertation
Wintersemester 2012/2013: Promotionsaufbaustudium
Keine belegten Veranstaltungen
Disputatio
Eric Achermann, Cornelia Blasberg, Klaus-Michael Köpcke
Do, 06.12.12, R 155, Vom-Stein-Haus
Die Bürde der Frühpromovierten
Zu seinem 100. Geburtstag im Jahre 2000 sprach Bernd H. Stappert mit dem Philosophen und Jubilar Hans-Georg Gadamer. Auf die Frage: »Hat Ihr Vater denn noch miterlebt, wie Sie, an sich doch sehr früh, als Zweiundzwanzigjähriger, schon promovierten?«, antwortete Gadamer:
»Ja, natürlich, er ist mit, kurz vor meiner Habilitation ist er gestorben. Aber wissen Sie, eine solche Habilitation [Promotion, NSE] mit zweiundzwanzig Jahren ist eine Kinderei, eigentlich doch die Schuld der Lehrer, denn daß das nichts taugt, ist doch klar, was man da macht und was man da kann.«
Diese lapidare Äußerung, dieses kritische Urteil Paul Natorps und Nicolai Hartmanns gegenüber, bei denen Gadamer mit der 127 Blatt umfassenden Arbeit Das Wesen der Lust nach den platonischen Dialogen promoviert worden war, erinnerte mich an eine Äußerung des damaligen Direktors des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft der WWU Münster, Clemens-Peter Herbermann (1941-2011). In seiner Vorlesung »Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen« im Wintersemester 2004/2005 urteilte Herbermann über die Dissertationsschrift des Philosophen Johann Christoph Hoffbauer (1766-1827), mit der er sich zugleich habilitierte, Tentamina semiologica, si ve quaedam generalem theoriam signorum spectantia, daß diese »nicht sonderlich bedeutsam« sei und daß sie »das Niveau einer lateinisch verfaßten Seminararbeit« aufweise. (Mitschrift NSE, 28. Oktober 2004)
Hoffbauer ist zum Zeitpunkt seiner Promotion/Habilitation dreiundzwanzig Jahre alt gewesen.
»Aus den Archiven: Hans-Georg Gadamer. Von der Kunst zu verstehen.« Deutschlandfunk: Sein und Streit. Das Philosophiemagazin, 6. September 2020, 11:41-12:03, http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2020/09/06/aus_den_archiven_hans_georg_gadamer_von_der_kunst_zu_drk_20200906_1322_62c05050.mp3.
Jenseitige Lektüre
In der bekannten und populären Rubrik »By the Book« der New York Times stand kürzlich das inzwischen achtzigjährige Ex-Monty-Python-Mitglied John »silly walk« Cleese Rede und Antwort. Auf die Frage, wie er seine Bücher ordnen würde, antwortete Cleese: »Gar nicht. Ich habe Bücher, die über den ganzen Planeten verstreut sind, wie meine Ex-Frauen. Wenn ich sterbe, lasse ich alle ungelesenen mit mir begraben. Mein Grab wird ›Mount Cleese‹ heißen.«
Der globalisierte Leser ist zugleich ein globalisierter Liebhaber, der das Ungelesene mit ins Jenseits nimmt. Kurioserweise existiert bereits seit 2007 ein Mount Cleese: Die neuseeländische Stadt Palmerston North benannte damals eine Mülldeponie nach dem britischen Komiker als Reaktion auf dessen Äußerung, Palmerston North sei »die Selbstmordhauptstadt Neuseelands«. Cleese riet in einem Podcast: »Wenn Sie sich umbringen wollen, aber nicht den Mut dazu haben, denke ich, daß ein Besuch in Palmerston North den Zweck erfüllen wird.«
»John Cleese Intends to Have His Unread Books Buried With Him.« The New York Times, Sept. 3, 2020, www.nytimes.com/2020/09/0…
»Mt. Cleese.« Atlas Obscura, www.atlasobscura.com/places/mt…